Die neue Sanftheit
Seit Jahrhunderten wird die Menschheit immer rücksichtsvoller. Der Fortschritt dieses Zivilisationsprozesses, wie Norbert Elias ihn genannt hat, lässt sich an zeittypischen Gewohnheiten ablesen. Heute erleben wir einen neuen Bändigungsschub. Aber auch eine Gegenreaktion.
Fast die Hälfte unserer täglichen Handlungen sind Gewohnheiten: Wann wir aufstehen, was wir essen und anziehen, dass wir Zähne putzen und uns duschen und ob wir Sport treiben und lesen, ist eine Frage jahrelanger Einübung, bis diese zu Automatismen gerinnt. Nehmen wir unsere Denkgewohnheiten hinzu – wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, Menschen einschätzen und Probleme angehen – sowie unser Verhalten im Alltag – ob wir freundlich oder gelassen, fordernd oder zurückhaltend auftreten –, bleibt kaum etwas übrig, das nicht von Gewohnheiten durchtränkt wäre. Dennoch haben wir ein zwiespältiges Verhältnis zu ihnen. Es gibt gute Gewohnheiten, Routinen und Rhythmen, die uns die Bewältigung des Alltags erleichtern, sie entlasten das Gehirn, das sich mit wichtigen Entscheidungen befassen kann, während es die zweitrangigen an das Gewohnheitstier in uns delegiert. Aber es gibt auch schlechte Gewohnheiten, die wir ablegen wollen. Um sie kreisen Ratgeberliteratur, Lifecoaches und Neujahrsvorsätze, die auf Veränderung abzielen.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Norbert Bolz: „Szenarien sind nicht die Wirklichkeit“
Der Klimakrise mit Angst zu begegnen, scheint der Sache angemessen. Oder zeigt sich hier ein bedenklicher Habitus unserer Zeit? Ein Gespräch mit dem Philosophen Norbert Bolz

Jetzt am Kiosk: Bin ich meine Gewohnheit?
Gewohnheiten geben uns Halt, festigen unsere Fähigkeiten und formen unseren Charakter. Und doch können sie uns fremd werden, uns vorkommen wie ein blinder Automatismus. Was tun angesichts dieser Ambivalenz? Wie lassen sich Gewohnheiten verändern, wenn wir – wie vielleicht jetzt zum Jahresbeginn – neue Wege einschlagen wollen?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
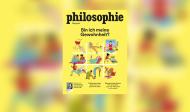
Florian Werner: „Es gibt eine Sprache der Zunge, die ohne Worte auskommt“
Sie ist Sprachinstrument und Geschmacksorgan, mit ihr küssen wir unsere Liebsten und strecken sie anderen als Zeichen der Missachtung heraus. Im Interview zu seinem neuen Buch Die Zunge erläutert Florian Werner, warum sich der Geist einer Zeit an ihrer Zungenspitze ablesen lässt.

19. Türchen
Von der Neuerscheinung bis zum Klassiker: In unserem Adventskalender empfiehlt das Team des Philosophie Magazins bis Weihnachten jeden Tag ein Buch zum Verschenken oder Selberlesen. Im 19. Türchen: Unsere Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler rät zu Über den Prozess der Zivilisation von Norbert Elias (Suhrkamp, 520 S., 18 €)

Ritual und Zwang
Gewohnheiten geben Halt. Doch der Übergang vom beruhigenden Ritual zum neurotischen Zwang ist fließend. Dafür, welche Art von Gewohnheiten wir ausbilden, spielt die Gesellschaft eine entscheidende Rolle.

Woher kommt das Neue?
Es gibt diesen Punkt, an dem das Alte nicht mehr passt. Mit einem Mal werden Gewohnheiten schal, Gewissheiten brüchig, Routinen und Rituale zu eng. Aber was tun, wenn die Sehnsucht nach dem Neuen erwacht, während unklar ist, wo es zu suchen wäre? Wie soll es sich einstellen, das Neue? Woher kann es kommen? Aus uns selbst oder aus dem Nichts? Ist das Neue überhaupt eine Befreiung – oder ein gesellschaftlicher Imperativ im Zeichen des technischen Fortschritts? Bleib up to date! Erfinde dich neu! Sei kreativ! Das sind die Losungen unserer Zeit, deren permanenter Wandel uns zur Anpassung zwingt. Wagen wir also den Sprung ins Ungewisse, um zu finden, was noch nicht da ist.
Elias Canetti: „Innerhalb des Parlaments darf es keine Toten geben“
Donald Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania beinahe ermordet. In seiner wirkmächtigen Schrift Masse und Macht hat Elias Canetti dargelegt, inwiefern das Zwei-Parteien-System die psychologische Struktur des Bürgerkriegs noch in sich trägt – und wo die Gewalt im politischen Kampf ihre Grenze findet.

Was schulde ich meiner Familie?
Das Konzept Familie fordert das moderne Individuum permanent heraus. Lässt sich der eigene Freiheitsdrang mit familiären Pflichten vereinen? Wie schwer wiegt der eigene Wille nach Selbstverwirklichung? Ist es legitim, im Zweifesfall eigene Wege zu gehen – und gilt dieses Recht für Mütter und Väter gleichermaßen? Barbara Bleisch streitet mit Norbert Bolz