Thomas Müntzer und die Geburt des Kommunismus aus dem Geist der Mystik
Heute vor 500 Jahren wurde Thomas Müntzer in Mühlhausen hingerichtet. Als Rivale Martin Luthers trat er an der Seite der Bauern im Kampf gegen die Knechtschaft an. Sein mystischer Kommunismus könnte auch heute noch in die Zukunft weisen.
Thomas Müntzer ist ein Lehrbuchbeispiel für dialektischen Umgang mit Institutionen: Der Pfarrer aus Stolberg im Harz, eingesetzt, um die Ordnung zu stützen, wurde in den 1520er Jahre zum Anführer eines Aufstands gegen die Ordnung. Anfangs ein Anhänger Martin Luthers, trieb er dessen Reformation ins Politische und wurde, während Luther als Fürstenknecht auftrat, zum Fürstenschreck. Müntzer wollte Ständeprivilegien abschaffen, den Armen ein besseres Leben ermöglichen und ein ganz „anderes Regiment“ errichten, eine Frühform des Kommunismus.
Theologe der Revolution
Dieser „Alles-gehört-allen“-Kommunismus war ein Produkt der Theologie und Mystik, die keine vermittelnden Instanzen wie Kirche und Obrigkeit duldete, sondern nur die Erfahrung des Heiligen Geistes durch den Einzelnen. Beeinflusst von der deutschen Mystik des Mittelalters, witterte Müntzer Gott in allen Menschen. Und wenn er in jedem haust, warum soll man dann noch auf Autoritäten hören? Als „Knecht Gottes“ hatte man ja schon einen Herrn; wäre es da nicht Frevel und Störung des immerwährenden Gottesdienstes, einem anderen zu folgen? Und ist es dann nicht eine Pflicht, die Ketten abzuschütteln und den Aufstand zu wagen, um selbst ganz bei sich und Gott sein zu können?
Zumal die Herren mit ihrer Herrschaft heillos überfordert schienen, wie Müntzer 1524 anprangerte: „Die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei“ sind „unser Herrn und Fürsten, nehmen alle Kreaturen zum Eigentum: die Fisch im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muß alles ihr sein.“ Mit diesem angemaßten Eigentum gingen sie, so Müntzer, nicht gerade behutsam um, sondern „schinden und schaben“ „alles, das da lebt“. So „machen“ „die Herren das selber, daß ihnen der arme Mann feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es die Länge gut werden? So ich das sage, muß ich aufrührisch sein!“
Müntzers Funke sprang über und entfachte einen Aufstand der thüringischen Bauern, der, bevor er sich zur Revolution ausweiten konnte, bei Frankenhausen blutig niedergeschlagen wurde. Damit war diese erste neuzeitliche Regung des Kommunismus verschwunden, aber der (Heilige) Geist der Revolution blieb.
Spätere Kommunismen pochten bekanntlich auf ihre revolutionäre Nüchternheit und wollten alles Religiöse ausmerzen. Vielleicht wurden sie deshalb so langweilig und brutal. Möglicherweise steckte dahinter ein Selbsthass auf die eigene spirituelle Wurzel, der überwunden werden muss, wenn der Kommunismus noch einmal eine Rolle spielen will.
Nachmoderner Kommunismus
Heute gilt der Kommunismus als mausetot. Doch vielleicht hält er nur Winterschlaf. Hat er dies nicht immer wieder getan? Für Alain Badiou gibt es verschiedene kommunistische Sequenzen und konterrevolutionäre Unterbrechungen, seit Gracchus Babeuf den modernen Kommunismus in der Französischen Revolution erfand, der jedoch im Keim erstickt wurde. Einen zweiten Höhepunkt gab es 1871 mit der Pariser Commune, die im Gemetzel der Polizei von Paris endete. Erst 1917 gab es einen neuen Anlauf, eine neue Sequenz, die bis 1989 dauerte. Seither ist es still geworden um den Kommunismus. Doch vielleicht kommt, so Badiou, bald ein neuer: Klimawandel, Pandemien, weltweite Ungleichheit, Migration und Kriege verlangen eine neue Globalgemeinschaft, die der nationalstaatlich zerklüftete Kapitalismus nicht herstellen könne. Auch das alte Sowjetsystem mit seinem starren Verwaltungsapparat wäre dazu nicht in der Lage. Es müsste ein ganz neuer Kommunismus sein.
Ist dies nicht die Bresche, in die Thomas Müntzer springen könnte? Sein Kommunismus lebte von der Erwartung des kommenden Weltreichs von unten. Aus einer zornigen Menge formte er ein Heer von Bauern zur Zerschlagung der Staatsapparate und zur Übernahme der Macht, um es besser zu machen.
Vielleicht besteht der mystische Zusatz heute darin, dass man Gott nicht nur in allen Menschen erkennt, sondern auch in allen Bäumen, Winden, Tieren und Dingen, die, so Jacob Böhme, Münder haben und zu uns sprechen. Hören wir ihnen zu und nehmen wir sie in unsere Diskurs- und Anerkennungsgemeinschaft auf, dann ergeben sich ganz andere politische Projekte als im bisherigen Kommunismus.
Der Kommunismus wäre dann die Vereinbarung verschiedener Lebendigkeitsansprüche von Mensch und Nicht-Mensch, wozu erste und zweite Natur gehören, Biologie und Technologie, Bäume und Roboter, unsere Voraussetzungen und Schöpfungen, die alle miteinander verschmelzen.
Hat Müntzer nicht etwas Ähnliches im Sinn gehabt, als er Gott in den Menschen hineinverlegte? Dieser wurde damit zu einem Teil des „All-Ganzen“, das nicht von Schrift und Autorität gelenkt wird, sondern von der inneren Erfahrung, die sich der Herrschaft entzieht.
Gut möglich also, dass der nachmoderne Kommunismus dem vormodernen gleicht und weniger nach einem neuen Lenin, Marx oder Babeuf als nach einem neuen Thomas Müntzer Ausschau halten muss, der die Welt und die Bauern mit dem Zauberstab der Mystik zum Klingen bringt. •
Weitere Artikel
Martin Luther und die Angst
Sein kultureller Einfluss ist nicht zu überschätzen: Martin Luthers Bibelübersetzung bildet den Anfang der deutschen Schriftsprache, seine religiösen Überzeugungen markieren den Beginn einer neuen Lebenshaltung, seine theologischen Traktate legen das Fundament einer neuen Glaubensrichtung. In der Lesart Thea Dorns hat Luther, der heute vor 479 Jahren starb, die Deutschen aber vor allem eines gelehrt: das Fürchten. Oder präziser: die Angst. In ihrem brillanten Psychogramm des großen Reformators geht die Schriftstellerin und Philosophin den Urgründen von Luthers Angst nach – und deren uns bis heute prägenden Auswirkungen.

Unter Spannung – Zum 800. Geburtstag des Synthetisierers Thomas von Aquin
Thomas von Aquin gehörte zu den großen Philosophen des Mittelalters. Sein Denken schlug eine Brücke zwischen Vernunft und Glauben, Begründung und Autorität. Vor 800 Jahren wurde Thomas im mittelitalienischen Roccasecca geboren.

Der Traum bleibt ein Traum
Heute vor 60 Jahren hielt Martin Luther King seine Rede „I have a Dream“. Sie ist nicht nur historisches Dokument eines bis heute ausgetragenen Kampfs gegen die Ungleichstellung von Schwarzen in den USA, sondern an ihr lassen sich auch die Konfliktfelder der politischen Gegenwart nachzeichnen.

Kohei Saito: „Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind das neue Opium des Volkes“
Mit seinem Entwurf eines Degrowth-Kommunismus ist Kohei Saito in Japan ein Überraschungsbestseller gelungen, der sich über 500.000 Mal verkauft hat. Im Interview erläutert der Philosoph, warum das Klima innerhalb des Kapitalismus nicht zu retten ist, weshalb wir nicht auf die Revolution warten sollten und was die Aktivisten der Letzten Generation von Karl Marx lernen können.
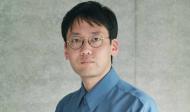
Thomas Metzinger: „Der menschliche Geist scheint in der Klimakatastrophe seinen Meister gefunden zu haben“
Der Blick auf die Prognosen zum Klimawandel verheißt Düsteres. Wie angesichts dieser Situation nicht in Lethargie oder Verzweiflung verfallen? Der Philosoph Thomas Metzinger erläutert, warum wir eine neue „Bewusstseinskultur“ brauchen und Meditation uns bei der Krisenbewältigung helfen könnte.

Bruno Leipold: „Marx’ zentrales Anliegen ist die Freiheit“
Wird Politik im Kommunismus überflüssig? Nein, meint Bruno Leipold, der das Bild vom antipolitischen Marxismus zu widerlegen sucht. Ein Gespräch über Marx als Republikaner, die Pariser Kommune und darüber, wie eine wirkliche Herrschaft des Volkes aussehen könnte.

Die sichtbare Hand des Marktes
Es war keine utopische Spukgeschichte: Als Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem 1848 erschienenen Manifest jenes „Gespenst des Kommunismus“ beschworen, das Kapitalisten in Enteignungsangst versetzen sollte, war das für sie vielmehr eine realistische Zukunftsprognose. Denn Marx und Engels legten großen Wert darauf, dass es sich im Kontrast zu ihren frühsozialistischen Vorläufern hier nicht um politische Fantasterei, sondern eine geschichtsphilosophisch gut abgesicherte Diagnose handle: Der Weltgeist sieht rot.

Guillaume Martin: „Ich habe Nietzsches Worte zu meinem Mantra gemacht“
Der Radrennfahrer Guillaume Martin, Kapitän des Cofidis-Teams, lag bei der aktuellen Tour de France zwischenzeitlich auf dem dritten Platz und rangiert moment als 11. des Gesamtklassements. Doch Martin, der noch immer die Top Ten anstrebt, ist auch studierter Philosoph, der in Frankreich das Buch Sokrates auf dem Velo (Grasset, 2019) veröffentlichte. Kurz vor den anstehenden Alpenetappen sprachen wir mit ihm über die bisherige Tour und seine Begeisterung für Friedrich Nietzsche.
