Der unbewegte Beweger
Institutionen nehmen bei Kafka eine doppelte Rolle ein: Während er seinen bürokratischen Beruf als Hindernis empfand, sind überpersönliche Machtapparate in seinem Werk oft die eigentlichen Treiber der Handlung.
„Es kommen (…) immer nur abreißende Anfänge zu Tage, abreißende Anfänge“. Diese Worte hält Franz Kafka, merklich resigniert, am 5. November 1911 in seinem Tagebuch fest. An anderer Stelle schreibt er auch vom „Unglück eines fortwährenden Anfangs“ und dem „Fehlen der Täuschung darüber, daß alles nur ein Anfang und nicht einmal ein Anfang ist“.
Auch in zahlreichen Briefen sucht Kafka nach dem Grund für das Gefühl, immer wieder ganz vorne, ja sogar noch davor, praktisch im Nichts beginnen zu müssen. Und immer wieder lautet seine Antwort: Der „Brotberuf“ ist schuld, wie er seine Tätigkeit in der „Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag“ selbst bezeichnet. Die Arbeit in der Institution nimmt ihn derart in Anspruch, dass die Kraft für das Erzählen eines Ganzen immer genau dann fehlt, wenn sie am dringendsten nötig ist.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
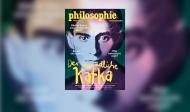
Rüdiger Safranski: „Kafka pflegt einen Absolutismus der Literatur“
Existenzielle Schuldgefühle plagten Kafka, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Ihr Ursprung, meint Rüdiger Safranski, liegt im Konflikt zwischen Leben und Schreiben. Im Gespräch erläutert er, wie Kafka beide Pole fast versöhnt und was seine Texte philosophisch so ergiebig macht.

Kafka als Zeichner
Franz Kafka schrieb nicht nur Weltliteratur, wie ein Band mit seinen Zeichnungen enthüllt. In diesen Werken zeigt sich der Humor des großen Schriftstellers. Dieser Text ist zuerst bei Monopol erschienen.

Für die Freiheit, gegen den Libertarismus
Der Historiker Timothy Snyder attackiert das libertäre Denken – und zeigt, dass eine bloß „negative Freiheit“, verstanden als Beseitigung staatlicher Hindernisse, die USA an den Abgrund treibt.

Das digitale Böse
Wie physische Handlungen können auch digitale Handlungen moralisch gut oder böse sein. Der Philosoph Jörg Noller erläutert das Konzept des „digitalen Bösen“ anhand von drei Hauptbereichen der Digitalisierung: Internet, Computerspiele und künstliche Intelligenz.

W. E. B. Du Bois – Pionier antirassistischen Denkens
Während sich die USA auf die Wahl ihres nächsten Präsidenten vorbereiten, stehen die Kämpfe um Identität und gegen Diskriminierung mehr denn je im Mittelpunkt der nordamerikanischen Herausforderungen. Der amerikanische Soziologe W. E. B. Du Bois hat wertvolle konzeptuelle Werkzeuge zum Verständnis von Rassismus geliefert, darunter auch den Begriff des „doppelten Bewusstseins“.

Die Dialektik der Zukunft – 50 Jahre „Die Grenzen des Wachstums“
Das Buch Die Grenzen des Wachstums ist nicht nur eine der ambitioniertesten Studien zur Zukunft der Weltwirtschaft, sondern auch wesentlicher Treiber der Klimabewegung. Grund genug, um zum 50. Geburtstag des Werkes nach den Möglichkeiten der Zukunftsbestimmung zu fragen.

Kafka – der Flüchtige
Kafka scheint eindeutigen Zuordnungen und politischen Großprojekten eine Absage zu erteilen. Poststrukturalisten lesen ihn als Autor des Werdens, sein Werk als „Poetik der Nicht-Zugehörigkeit“. Was aber, wenn auch diese Lesart eine Vereinnahmung darstellt?
