Fokus für Fluchttiere
Die Hölle, das ist ein Großraumbüro. Was im besten Fall ein Ort des kreativen Austauschs ist, entpuppt sich oft als Hort der Ablenkung.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die Hölle, das sind die Anderen?
Wohin man auch blickt: überall Andere! Nicht immer ist ihre Anwesenheit ein Segen: Allzu oft stören sie, nerven, machen einem das Leben gar regelrecht zur Hölle. Andererseits, wer wollte ernsthaft ohne andere Menschen leben? Ohne deren Berührung, Mitgefühl, Inspiration? Besonders herausfordernd ist der Andere in seiner Rolle als kulturell Fremder. Was tun? Tolerieren, diskutieren, drangsalieren – oder ihn einfach mutig ins Herz schließen? Fragen, die direkt in das Zentrum unserer modernen Einwanderungsgesellschaften führen.
Elite, das heißt zu Deutsch: „Auslese“
Zur Elite zählen nur die Besten. Die, die über sich selbst hinausgehen, ihre einzigartige Persönlichkeit durch unnachgiebige Anstrengung entwickeln und die Massen vor populistischer Verführung schützen. So zumindest meinte der spanische Philosoph José Ortega y Gasset (1883–1955) nur wenige Jahre vor der Machtübernahme Adolf Hitlers. In seinem 1929 erschienenen Hauptwerk „Der Aufstand der Massen“ entwarf der Denker das Ideal einer führungsstarken Elite, die ihren Ursprung nicht in einer höheren Herkunft findet, sondern sich allein durch Leistung hervorbringt und die Fähigkeit besitzt, die Gefahren der kommunikationsbedingten „Vermassung“ zu bannen. Ortega y Gasset, so viel ist klar, glaubte nicht an die Masse. Glaubte nicht an die revolutionäre Kraft des Proletariats – und wusste dabei die philosophische Tradition von Platon bis Nietzsche klar hinter sich. Woran er allein glaubte, war eine exzellente Minderheit, die den Massenmenschen in seiner Durchschnittlichkeit, seiner Intoleranz, seinem Opportunismus, seiner inneren Schwäche klug zu führen versteht.
Eine Frage der Verfügbarkeit
Nur wenige Tage nachdem der AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 zeitweise zurückgehalten wurde, ist er nun wieder freigeben. Was viele als eine überhastete Entscheidung betrachteten oder gar für einen groben Fehler hielten, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein Fehlschluss, den wir alle alltäglich begehen.

Michel Foucault – sind Sie es?
Viele sind verwundert über den Foucault, den sie im jüngst aus dem Nachlass erschienenen Buch Der Diskurs der Philosophie entdecken. Nicht so Christoph Paret. Für ihn entpuppt sich der französische Denker darin als das, was er schon immer war: ein Sezessionist.
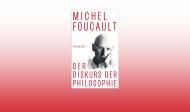
Der Bruder als trojanisches Pferd?
Russlands Überfall auf die Ukraine ist, so hört man oft, ein „Bruderkrieg“. Was manchen als tragische Anomalie erscheint, ist aber tatsächlich der Normalfall. Ein Impuls von Moritz Rudolph.

Wer sind "Wir"?
Als Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das!“ aussprach, tat sie dies, um die Deutschen zu einer anpackenden Willkommenskultur zu motivieren. Aber mit der Ankunft von einer Million Menschen aus einem anderen Kulturkreis stellt sich auch eine für Deutschland besonders heikle Frage: Wer sind wir eigentlich? Und vor allem: Wer wollen wir sein? Hört man genau hin, zeigt sich das kleine Wörtchen „wir“ als eine Art Monade, in der sich zentrale Motive zukünftigen Handelns spiegeln. Wir, die geistigen Kinder Kants, Goethes und Humboldts. Wir, die historisch tragisch verspätete Nation. Wir, das Tätervolk des Nationalsozialismus. Wir, die Wiedervereinigten einer friedlichen Revolution. Wir, die europäische Nation? Wo liegt der Kern künftiger Selbstbeschreibung und damit auch der Kern eines Integrationsideals? Taugt der Fundus deutscher Geschichte für eine robuste, reibungsfähige Leitkultur? Oder legt er nicht viel eher einen multikulturellen Ansatz nahe? Offene Fragen, die wir alle gemeinsam zu beantworten haben. Nur das eigentliche Ziel der Anstrengung lässt sich bereits klar benennen. Worin anders könnte es liegen, als dass mit diesem „wir“ dereinst auch ganz selbstverständlich „die anderen“ mitgemeint wären, und dieses kleine Wort also selbst im Munde führen wollten. Mit Impulsen von Gunter Gebauer, Tilman Borsche, Heinz Wismann, Barbara Vinken, Hans Ulrich Gumbrecht, Heinz Bude, Michael Hampe, Julian Nida-Rümelin, Paolo Flores d’Arcais.
KI: Zwischen Verheißung und Verhängnis
KI-Revolution oder allgemeine Ernüchterung? Die befreundeten Philosophen Florian Chefai und Jannis Puhlmann streiten über Potenzial und Grenzen der Künstlichen Intelligenz – von kreativen Durchbrüchen über psychosefördernde Chatbots bis hin zu synthetischem Bewusstsein. Ein Dialog.

Lauter Likes für leere Gaben
Überraschungsbesuche zu Geburtstagen sind ein Trend auf Social Media. In diesen Videos macht sich der unverhoffte Gast selbst zum Geschenk. Doch was zunächst rührend scheint, entpuppt sich als Geste des Egoismus.
