Der Ritt der Träume
Krankheit, Selbstzweifel und eine qualvolle Beziehung zum Vater prägten Kafkas Leben. Doch sein Leid war gleichzeitig der Quell seines Schaffens, meint Peter-André Alt. Über einen Schriftsteller, der bis zuletzt Angst vor dem Scheitern hatte – und so ein einzigartiges Werk schuf.
Im Februar 1922, knapp zweieinhalb Jahre vor seinem Tod, beschreibt Franz Kafka in einer kurzen Notiz mit schwebenden Worten eine sonderbare Kunst: „Es ist eine schöne und wirkungsvolle Vorführung, der Ritt den wir den Ritt der Träume nennen. Wir zeigen ihn schon seit Jahren, der welcher ihn erfunden hat, ist längst gestorben, an Lungenschwindsucht, aber diese seine Hinterlassenschaft ist geblieben und wir haben noch immer keinen Grund den Ritt von den Programmen abzusetzen, umsoweniger, als er von der Konkurrenz nicht nachgeahmt werden kann, er ist, trotzdem das auf den ersten Blick nicht verständlich ist, unnachahmbar.“ Es ist nicht wirklich klar, was Kafka mit diesen zwei Sätzen ausdrücken wollte. Sie muten an wie eine versteckte Selbstdeutung, die der bis heute andauernden Wirkungsmacht seiner Texte gilt. Diese sind in der Tat „Traumritte“, sie faszinieren das Publikum und bleiben, wenngleich oft imitiert, doch „unnachahmbar“. Zur unheimlichen Prognostik der Passage gehört auch, dass sie den Erfinder der „schönen Vorführungen“ als an Tuberkulose Gestorbenen beschreibt – an ihr war Kafka seit dem Herbst 1917 erkrankt, ihr wird er im Juni 1924 knapp 41-jährig erliegen.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
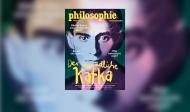
Dirk Oschmann: „Was mit Freiheit zu gewinnen wäre, bleibt unklar“
Das Versprechen der Freiheit ist ein zentraler Baustein der Moderne. In Kafkas Romanen zeigt sie dagegen ihre Schattenseite, erklärt Dirk Oschmann. Ein Gespräch über das Vertrautsein mit der Welt, Amerika als Strafkolonie und Kafkas „Stufen der Scheinbarkeit“.

Rechtsleere
Advokaten, Richter und Beamte bevölkern Kafkas Universum. So detailliert der moderne Rechtsstaat aber auch beschrieben wird, so unklar bleibt seine innere Funktionsweise. Besteht gerade darin Kafkas Rechtskritik?

Demokratie als Lebensform – Nachruf auf Oskar Negt
Am 2. Februar verstarb der Soziologe und Philosoph Oskar Negt. In seinem Nachruf erinnert sich Josef Früchtl an einen Menschen, der stets offen für Widerspruch blieb, und an einen Denker, der den Zusammenhang zwischen Politik und Gefühl ins Zentrum seines Schaffens stellte.

Vivian Liska: „Kafka weist jegliche Theodizee zurück“
Auch wenn Kafkas Texte selten explizit von Religion handeln, wurden sie als Auseinandersetzung mit dem Urteil Gottes gelesen. Ein Gespräch mit Vivian Liska über Kafkas Verhältnis zum Judentum, eine unmögliche Suche und den sabotierten Turmbau zu Babel.

Wie schaffen wir das?
Eine Million Flüchtlinge warten derzeit in erzwungener Passivität auf ihre Verfahren, auf ein Weiter, auf eine Zukunft. Die Tristheit und Unübersichtlichkeit dieser Situation lässt uns in defensiver Manier von einer „Flüchtlingskrise“ sprechen. Der Begriff der Krise, aus dem Griechischen stammend, bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Lage mit offenem Ausgang – und so steckt in ihm auch die Möglichkeit zur positiven Wendung. Sind die größtenteils jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen, nicht in der Tat auch ein Glücksfall für unsere hilf los überalterte Gesellschaft? Anstatt weiter angstvoll zu fragen, ob wir es schaffen, könnte es in einer zukunftszugewandten Debatte vielmehr darum gehen, wie wir es schaffen. Was ist der Schlüssel für gelungene Integration: die Sprache, die Arbeit, ein neues Zuhause? Wie können wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, einbinden in die Gestaltung unseres Zusammenlebens? In welcher Weise werden wir uns gegenseitig ändern, formen, inspirieren? Was müssen wir, was die Aufgenommenen leisten? Wie lässt sich Neid auf jene verhindern, die unsere Hilfe derzeit noch brauchen? Und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Mit Impulsen von Rupert Neudeck, Rainer Forst, Souleymane Bachir Diagne, Susan Neiman, Robert Pfaller, Lamya Kaddor, Harald Welzer, Claus Leggewie und Fritz Breithaupt.
Catherine Camus: „Mein Vater sah mich, wie ich war“
Väter sind besondere Menschen in unserer aller Leben. Im Guten oder im Schlechten. In diesem Interview erinnert sich Catherine Camus, die Tochter von Albert Camus, an ihre Kindheit, den früh verstorbenen Vater und das moralische Gewicht seines Erbes.

Kafka – Stationen eines Lebens
Franz Kafka war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Liebhaber, Bruder, Jude, Angestellter, Briefschreiber, Kinogänger.
Die ihn prägenden Beziehungen, historischen Ereignisse und seine wichtigsten Werke zeigt dieser Überblick.
