Dialektik der Gewohnheit
Kraft der Wiederholung sind Gewohnheiten identitätsstiftend und gerade deshalb engen sie uns schnell ein. Sie bestimmen, wie wir wahrnehmen, was wir tun oder lassen – manchmal auch im Schlechten. Wie umgehen mit diesen Widersprüchen?
Tugend durch Training
Aristoteles
384 – 322 v. Chr.
Es sind unsere Gewohnheiten, die darüber entscheiden, ob wir zu tugendhaften oder zu lasterhaften Menschen werden
Sie wären gerne aufmerksam, großzügig und mutig und haben theoretisch eine Vorstellung davon, was das bedeuten würde? Aber in den entscheidenden Situationen misslingt es Ihnen, das Richtige zu tun? Der obdachlosen Person geben Sie nichts, weil Sie zu müde sind, die Not des Nachbarn übersehen Sie, weil Sie ins Grübeln versunken sind, und dem Unfallopfer helfen Sie nicht, weil Sie zu erschrocken sind?
Laut Aristoteles liegt Ihr Problem in mangelnder Übung. Es fehlt Ihnen an den richtigen Gewohnheiten, durch die sich die moralischen Reflexe ausbilden. Für Aristoteles werden wir nämlich nicht allein durch Einsicht und Belehrung moralisch, und wir sind es auch nicht einfach von Natur aus (obwohl es wohl einige Menschen gibt, die eine stärkere moralische Veranlagung haben). Vielmehr erwerben wir Charaktertugenden wie Mut und Großzügigkeit „durch vorheriges Tätigsein, so wie sonst auch die verschiedenen Arten von Künsten. Denn was man zu tun gelernt haben muss, das lernt man, indem man es tut. So wird man zum Baumeister, indem man Häuser baut, zum Kitharaspieler, indem man Kithara spielt.“ Während bei unseren natürlichen Fähigkeiten, wie etwa der, zu sehen und zu hören, die Fähigkeit der Tätigkeit vorausgeht, verhält es sich bei den Künsten und Tugenden Aristoteles zufolge andersherum: Wer sich immer wieder mutig verhält, wird schließlich wesenhaft mutig, was ihm wiederum in künftigen Situationen mutiges Verhalten erleichtert. Durch die Gewöhnung werden wir nicht nur besser im tugendhaften Verhalten, sondern das tugendhafte Verhalten wird zudem lustvoller, was wiederum die Motivation zu seiner Fortsetzung steigert. Umgekehrt üben wir über unsere Gewohnheiten allerdings auch Laster wie Feigheit und Geiz ein. Auch sie werden durch Wiederholung immer selbstverständlicher und angenehmer. Deshalb kommt es auf unser alltägliches Verhalten an, denn die Haltung, die wir in scheinbar unwichtigen Situationen einnehmen, hat Auswirkungen darauf, was wir angesichts größerer Herausforderungen tun werden.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Jetzt am Kiosk: Bin ich meine Gewohnheit?
Gewohnheiten geben uns Halt, festigen unsere Fähigkeiten und formen unseren Charakter. Und doch können sie uns fremd werden, uns vorkommen wie ein blinder Automatismus. Was tun angesichts dieser Ambivalenz? Wie lassen sich Gewohnheiten verändern, wenn wir – wie vielleicht jetzt zum Jahresbeginn – neue Wege einschlagen wollen?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
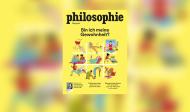
Woher kommt das Neue?
Es gibt diesen Punkt, an dem das Alte nicht mehr passt. Mit einem Mal werden Gewohnheiten schal, Gewissheiten brüchig, Routinen und Rituale zu eng. Aber was tun, wenn die Sehnsucht nach dem Neuen erwacht, während unklar ist, wo es zu suchen wäre? Wie soll es sich einstellen, das Neue? Woher kann es kommen? Aus uns selbst oder aus dem Nichts? Ist das Neue überhaupt eine Befreiung – oder ein gesellschaftlicher Imperativ im Zeichen des technischen Fortschritts? Bleib up to date! Erfinde dich neu! Sei kreativ! Das sind die Losungen unserer Zeit, deren permanenter Wandel uns zur Anpassung zwingt. Wagen wir also den Sprung ins Ungewisse, um zu finden, was noch nicht da ist.
Ritual und Zwang
Gewohnheiten geben Halt. Doch der Übergang vom beruhigenden Ritual zum neurotischen Zwang ist fließend. Dafür, welche Art von Gewohnheiten wir ausbilden, spielt die Gesellschaft eine entscheidende Rolle.

Männer und Frauen: Wollen wir dasselbe?
Manche Fragen sind nicht dazu da, ausgesprochen zu werden. Sie stehen im Raum, bestimmen die Atmosphäre zwischen zwei Menschen, die nach einer Antwort suchen. Und selbst wenn die Zeichen richtig gedeutet werden, wer sagt, dass beide wirklich und wahrhaftig dasselbe wollen? Wie wäre dieses Selbe zu bestimmen aus der Perspektive verschiedener Geschlechter? So zeigt sich in der gegenwärtigen Debatte um #metoo eindrücklich, wie immens das Maß der Verkennung, der Missdeutungen und Machtgefälle ist – bis hin zu handfester Gewalt. Oder haben wir nur noch nicht begriffen, wie Differenz in ein wechselseitiges Wollen zu verwandeln wäre? Das folgende Dossier zeigt drei Möglichkeiten für ein geglücktes Geschlechterverhältnis auf. I: Regeln. II: Ermächtigen. III: Verstehen. Geben wir Mann und Frau noch eine Chance!
Der Akrasia-Komplex
Ein entscheidender Grund für das Festhalten an schlechten Gewohnheiten ist die Akrasia. Zu Deutsch: Willensschwäche. Warum aber handeln Menschen gegen ihre Einsicht? Drei philosophische Positionen.

Kleine Grammatik des Widerstands
Das Präfix „Re-“ changiert zwischen Wiederholung und Veränderung, Wiederherstellung und Widerstand. Mit dieser Unentschlossenheit kann es aber auch schnell zu Abnutzungserscheinungen bei exzessivem Einsatz kommen, warnt Dieter Thomä.

Thomas Wagner: „In der Welt des Denkens gibt es immer Berührungspunkte“
Zeitlebens warnte der jüdische Denker Theodor W. Adorno, der in den 1930ern selbst ins Exil floh, vor der Bedrohung des Faschismus. Aus welchem Grund suchte er im Nachkriegsdeutschland den engen Austausch mit seinem konservativen Kollegen Arnold Gehlen, einem ausgewiesenen Unterstützer der Nationalsozialisten? Thomas Wagner über ideologische Gräben und intellektuelle Verbundenheit.

Warum wir Verschwörungstheorien manchmal ernst nehmen sollten
Der Angriff auf Trump führte schnell zu wilden Spekulationen. Um mit diesen angemessen umzugehen, sollten wir zwischen Verschwörungstheorie und -mythos unterscheiden.
