Die Flut, eine Kulturkatastrophe
Hochwasser und Überschwemmungen kosten Menschenleben und richten materielle Schäden an. Zu ihren fatalen Folgen gehört aber auch noch etwas anderes, das sich buchstäblich nicht beziffern lässt – und Gemeinschaften unwiederbringlich verändert.
Jede Katastrophe hat Bilder, mit denen sie sich in das kollektive Gedächtnis einschreibt. Zu jenen der jüngsten Hochwasserkatastrophe zählt ein Video des mit den Tränen kämpfenden Helmut Lussi, Bürgermeister von Schuld an der Ahr: „Diese Flut hat auch für die Menschen in Schuld oder wird für die Menschen in Schuld Narben hinterlassen. Und Narben, die man nicht vergisst, die nicht zu bewältigen sind.“ Dann wankt seine Stimme und reißt ab. In dem Bild liegt eine tiefe Einsicht: Trotz Wiederaufbau wird in dem Ort eine Lücke bleiben, die noch keine Worte angemessen beschreiben können.
Diese Sprachlosigkeit könnte Anlass sein, anderen vernarbten Menschen zuzuhören. Nick Estes etwa, Historiker und Bürger des Lower Brule Sioux Tribes, beschreibt in seinem 2019 erschienenen Buch Our History is the Future die soziokulturellen Schäden von Fluten. Nach den Dürren der 1930er Jahren, den „Dust Bowls“, setzte das U.S. Army Corps of Engineers entlang des Missouri Rivers ein umfassendes Bewässerungsprojekt um. Die Eigentumsrechte des fruchtbaren Gebiets um den Fluss waren zwischen US-amerikanischen Staatsangehörigen und mehreren indigenen Nationen aufgeteilt. Obwohl indigene Gebiete bereits in den Jahrzehnten zuvor kontinuierlich verkleinert wurden, entschied sich die US-Regierung aus Kostengründen, die Stauseen vor allem auf Reservate zu legen.
Weite Landflächen wurden dauerhaft und bewusst überflutet. Das Infrastrukturprojekt der US-Regierung entwickelte sich dadurch zu einem Ankerpunkt des zeitgenössischen panindianischen Aktivismus. Estes betont, dass die Gewalt dieser Flut erst aus der Ortsgebundenheit indigener Zeremonien und Traditionen heraus verstanden werden kann. Beides ist untrennbar mit heiligen Orten oder bestimmten Pflanzen- und Tierpopulationen verbunden – all das ging in den Stauseen dauerhaft verloren. Viele „zukünftige Beziehungen zum Land“ sind von ihnen unwiederbringlich zerstört worden. Keine Kompensationszahlungen könnten dies aufwiegen, da es dabei um „etwas völlig Unquantifizierbares“ ginge.
Ein anderes Land
Nun lassen sich Estes' Überlegungen natürlich nicht eins zu eins auf den europäischen Kontext übertragen, gleichwohl kann man sich mit ihnen aber einer Sprache über die katastrophische Lücke nach einer Flut nähern. Zunächst zeigt ein Vergleich, was die hiesige Lücke nicht ist. Hierzulande sind keine unabhängigen indigenen Nationen betroffen, sondern Städte und Gemeinden. Die Überlebenden wurden nicht vertrieben, sondern können zurückkehren. Beziehungen zum selben Land sind nach dem Wiederaufbau also möglich, vielleicht werden sie sogar intensiviert. Nach dem Elbhochwasser 2006 wurden immerhin nicht nur Flutkarten angefertigt, Versicherungen ausgestellt, Schutzvorrichtungen ausgebaut, sondern manche Gemeinden und Kommunen rückten auch enger zusammen.
Was sich von Estes' Beobachtungen jedoch durchaus übertragen lässt: Auch hierzulande greift die Vorstellung nicht, dass ein Ort seine Bedeutung nur aus sich selbst heraus gewinnt. Er empfängt sie wesentlich von den Menschen, die ihn bewohnen. Jede Naturkatastrophe ist deshalb auch eine Kulturkatastrophe. Das Ausmaß ihrer Zerstörung wird nicht einfach unter Abzug des Menschen, aus der Betrachtung von Kulturgütern begreiflich, sie liegt, mit dem Philosophen Ralf Konersmann gesprochen, auch in der Betroffenheit kultureller Tatsachen. Eine kulturelle Tatsache besteht etwa darin, dass man in einem Zuhause zu Hause ist und in einer Kirche Gottesdienste abhält. Für eine kulturelle Tatsache ist also ausschlaggebend, was man mit oder an einem Ort macht und was dies für einen bedeutet. Kulturelle Tatsachen gehen demnach nicht aus den Sachen selbst hervor, sie ergeben sich erst „aus den Bezüglichkeiten des Gegenstandes in seiner Welt.“
So erinnert Konersmann daran, dass, wo Kultur betroffen ist, „Faktenwelt“ immer auch „Menschenwelt“ ist. In Schuld an der Ahr etwa wurde die örtliche Kirche im Nachklang der Katastrophe schnell und pragmatisch zur Kleidersammlung umfunktioniert. Vielleicht nehmen in den Überschwemmungsgebieten manche wiederaufgebauten Straßen einen etwas anderen Verlauf. Ob die renovierten Gebäude tatsächlich wieder ein Zuhause werden können – und wenn ja, für wen –, das ist derzeit noch offen. Sogar NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bemerkte bei einem Besuch in den Flutgebieten, es würde „ein anderes Land werden in diesen Städten.“ Wenn sich eine Kulturkatastrophe ereignet, dann ist mehr als die materielle Ordnung beschädigt, auch die Ordnung der menschlichen Bezüglichkeiten ist betroffen. Es gibt eine Irritation in einem Netz von Bedeutungen.
Die Wirklichkeit steht schief
In den Hochwassergebieten schafft man immer noch den Schlamm beiseite, man entkernt Gebäude und birgt die Überreste. Das ähnelt fast einem archäologischen Unterfangen. Denn ähnlich dem, was eine Archäologin in die Hände bekommt, scheinen auch die geborgenen Überreste in den Flutgebieten aus einer anderen, fremden Zeit zu stammen. Zu einstmals selbstverständlichen Bezüglichkeiten herrscht nun eine unüberbrückbare Distanz. Und in eben dieser Distanz liegt der unquantifizierbare Schaden: Man hat lebendige Erinnerungen an einen Ort, gleichzeitig steht aber die Wirklichkeit zu diesen Erinnerungen schief.
Die Welt verliert ihre Eindeutigkeit. In dem Zuhause, was man da entkernt, war man tatsächlich mal zu Hause. Aber dieses Zuhause ist es jetzt nicht mehr. Man tritt ein in eine mehrdeutige Welt der trigger: Aus der offenkundigen Bedeutung kann man jederzeit in eine parallele entrücken. Auch Jahrzehnte später reicht hierfür noch ein Geruch, eine Straßenecke oder der Blick auf den etwas höher gebauten Damm. Die Verletzungen der kulturellen Katastrophe entstammen somit dem Verlust von Selbstverständlichkeit. Es ist dauerhaft fragwürdig geworden, dass das Selbstverständliche tatsächlich selbstverständlich ist und noch mehr, dass es das auch bleibt. •
Weitere Artikel
Wer ist mein wahres Selbst?
Kennen Sie auch solche Abende? Erschöpft sinken Sie, vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand, aufs Sofa. Sie kommen gerade von einem Empfang, viele Kollegen waren da, Geschäftspartner, Sie haben stundenlang geredet und kamen sich dabei vor wie ein Schauspieler, der nicht in seine Rolle findet. All diese Blicke. All diese Erwartungen. All diese Menschen, die etwas in Ihnen sehen, das Sie gar nicht sind, und Sie nötigen, sich zu verstellen … Wann, so fragen Sie sich, war ich heute eigentlich ich? Ich – dieses kleine Wort klingt in Ihren Ohren auf einmal so seltsam, dass Sie sich unwillkürlich in den Arm kneifen. Ich – wer ist das? Habe ich überhaupt so etwas wie ein wahres Selbst? Wüsste ich dann nicht zumindest jetzt, in der Stille des Abends, etwas Sinnvolles mit mir anzufangen?
Klimaproteste sind sehr wohl kriminell
Klimaaktivisten engagieren sich für ein wichtiges Ziel, doch illegale Aktionen richten letztlich mehr Schaden als Nutzen an. In einer Replik auf Eva von Redeckers aktuelle Kolumne argumentiert Frauke Rostalski dafür, dass Recht unabhängig von Motiven gelten muss. Eine Politisierung der Justiz verschärft lediglich gesellschaftliche Spaltung.

Können Tote E-Mails schreiben?
Seit jeher stellte die elektronische Fernkommunikation herrschende Vorstellungen des Todes infrage: Telegraf und Telefon hatten etwas buchstäblich Jenseitiges, sodass viele Zeitgenossen auf eine Hotline zu den Verstorbenen hofften. Heute, im durchdigitalisierten Zeitalter, offenbart sich dieses Phänomen auf neue Art: Wie umgehen damit, wenn Menschen nach ihrem Tod noch digital „weiterleben“?

Jens Timmermann: „Wir sind alle nicht so gut, wie wir sein sollten“
Im Zentrum der Kritik der praktischen Vernunft steht die Freiheit. Unter dieser verstand Kant jedoch etwas anderes als wir heute: Nicht wenn wir unseren Wünschen folgen, sind wir frei, sondern wenn wir dem moralischen Gesetz gehorchen. Jens Timmermann erklärt, warum wir Kant zufolge alle das Gute erkennen, doch nur selten danach handeln.

Åsa Wikforss: „Die Fakten hatten es noch nie leicht mit uns“
In Schweden können alle Abiturienten ihren Bestseller Alternativa Fakta kostenlos erhalten. Die Philosophin Åsa Wikforss, die zu den wichtigsten intellektuellen Stimmen des skandinavischen Landes gehört, erklärt im Gespräch die Ursachen zunehmender Wissensresistenz und was Gesellschaften dagegen tun können.

Die neue Ausgabe: Muss ich da mitmachen?
Ob im Netz oder in der analogen Welt: Menschen passen sich leicht an Gruppen an. Folgen Trends. Machen mit. Oft mit fatalen Folgen. Wie also werde ich innerlich freier? Was hilft mir, mich abzugrenzen? Nein zu sagen? Meinen eigenen Weg zu finden?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
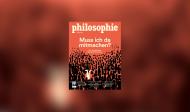
Das Ende der Illusionen
Spätestens die gewaltigen Waldbrände und verheerenden Fluten des vergangenen Jahres haben auch in den wohlhabenden Teilen der Welt ein Bewusstsein für die zerstörerische Kraft des Klimawandels geschaffen. Eindringlich appelliert Naomi Klein: Hören wir auf, so zu tun, als ob irgendjemand der ökologischen Katastrophe entkommen könnte.

Die Natur des Notwendigen
Seit Jahrtausenden befassen sich Philosophen mit der Frage, was es für ein gutes Leben wirklich braucht. Fokus und Übung? Alles und noch mehr? So wenig wie möglich? Etwas ganz anderes als den Status quo? Wir stellen Ihnen fünf verschiedene Typen vor.
