Die Proteste in China aus der Sicht Hegels
Die Proteste, die letzte Woche in China stattfanden, sind keine Überraschung der Geschichte oder auf den Willen Einzelner zurückzuführen. Es handelt sich vielmehr um einen dialektischen Prozess, der sich mit Hegel besser verstehen lässt.
Erstens: Das in China entstandene Covid-Virus ging einmal um die Welt, bevor es wieder zu seinem Entstehungsort zurückkehrte, jedoch verändert und mit neuen Charakteristiken: Die Pandemie war mörderisch, breitete sich jedoch in immer weniger gefährlichen Wellen aus, dank der zunehmenden kollektiven Immunität und der wirksamen Impfstoffe. Die meisten Länder reagierten zunächst vorsichtig und passten sich dann, oft mit Erfolg, an die neuen Varianten an. Die chinesische Regierung hingegen wandte eine abstrakte, starre und einheitliche Lösung an, die „Null-Covid“-Politik. Sie bekämpfte den Tod durch die Einführung strenger Beschränkungen, die durch eine unerbittliche Kontrolle gewährleistet wurden. Aber nach einer ersten erfolgreichen Phase, die die chinesische Führung auf ihrem Weg zur Weltherrschaft berauschte, wandelte sich der Prozess: die Verneinung des Todes wurde zur „Negation der Negation“, da die autoritären Beschränkungen das Bewusstsein der Bürger und ihre natürliche Vitalität einschränkten. In ihrer Überforderung ziehen es einige nun vor, aus ihrem „unglücklichen Bewusstsein“ auszubrechen. Aber diese „Aufhebung“ behält alles, was sie durchgemacht hat, in sich. Viele Demonstranten tragen Masken, um sich nicht anzustecken, während sie ihre Gesichter verbergen. Sie leugnen nicht die Gefährlichkeit von Covid, sondern den Zustand des sozialen Todes, in den sie durch die Politik ihrer Regierung gebracht wurden.
Zweitens ist es kein Zufall, dass der Funke, der die Revolte auslöste, in der Provinz Xinjiang entstand, wo ein Feuer aufgrund der absurden Strenge der Gesundheitsbeschränkungen zehn Menschenleben forderte. Ürümqi ist die Hauptstadt der Uiguren, die seit mehreren Jahren von Peking verfolgt werden. Auch hier kehrt die Geschichte zu einer ihrer Quellen zurück, jedoch angereichert durch die Erfahrung. Durch eine „List der Vernunft“ hat Xi Jinping, indem er die uigurische Kultur zerstören wollte, eine Solidaritätsbewegung der Han-Chinesen in Shanghai oder Peking mit dieser Minderheit ins Leben gerufen.
Die dritte dialektische Umkehrung: Da China zur Werkbank der Welt geworden ist und von einer Partei regiert wird, die die Interessen der Arbeiter verkörpert, kommt es in der weltgrößten iPhone-Fabrik des Unternehmens Foxconn zu einer sozialen Bewegung. Wie Hegel in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820 schreibt: „Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die Anhäufung der Reichtümer – denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird der größte Gewinn gezogen – auf der einen Seite, wie auf der andern Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, womit die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt.“ Die Arbeit formt den Menschen, aber sie macht ihn zum Sklaven der Produktion, sodass er in der Lage ist, sich durch die Produktion seiner selbst bewusst zu werden und sich dann gegen seinen Herrn zu wenden.
Der absolute Geist geht durch China
Die Bewegung der Geschichte wird jedoch nicht mit diesen Demonstrationen enden. Xi Jinping, der durchaus umstritten ist, wird vielleicht versuchen, den Volkswillen hinter seinem nationalistischen Projekt zu vereinen. Nach Hegel kann nur der Staat die Freiheit des Einzelnen konkret verkörpern. Und diese Verbindung zwischen Mensch und Staat kommt nie besser zum Ausdruck als im Krieg, den Hegel als einen „ethischen Moment“ der Geschichte definiert. Der Krieg ermöglicht es in der Tat, die „Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge […] [e]rnst“ zu nehmen, die die Individuen zu erwerben suchen (insbesondere in einer Gesellschaft des zügellosen Konsums), das negative Moment der Gefahr positiv zu gestalten. Wenn Xi Jinping die Revolte auslöschen und alle Chinesen hinter sich versammeln will, wird er wahrscheinlich versucht sein, den seit Jahren gehegten Plan umzusetzen, das widerspenstige Taiwan zu erobern – es sei denn, er schlägt die Bewegung blutig nieder.
Der „absolute Geist“, der das Werden der Welt in widersprüchlichen Schritten verwirklicht, geht derzeit durch China. Aber wenn Peking die Taiwaner angreift und die Taiwaner Widerstand leisten, ist diese Geschichte noch lange nicht zu Ende. „Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“, so fasste es Hegel und meinte damit, dass der tiefere Sinn all dessen, was auf den Straßen der chinesischen Städte geschieht, noch nicht endgültig erkannt werden kann. •
Weitere Artikel
Das Virus als Prozess
Politiker sprechen vom „Krieg“ gegen das Coronavirus. Der Systembiologe Emanuel Wyler plädiert dafür, Viren nicht als „Feinde“, sondern als Prozess zu verstehen. Das helfe auch beim Umgang mit der Pandemie.

Roger T. Ames: „Für Konfuzianer sind die Gewohnheiten die Kultivierung der Rollen und Beziehungen“
Wie denkt man in China über Gewohnheit nach? Der Philosoph Roger T. Ames lebt in Peking und erklärt, dass man in China nicht den eigenen Charakter, sondern seine Beziehungen in der Gemeinschaft ausbildet. Ein Gespräch über Gewöhnung als intergenerationaler Prozess, den Stellenwert der Familie und das chinesische Neujahr.

Axel Honneth: „Arbeit muss die politische Willensbildung fördern“
Die Demokratie lebt davon, dass Bürger sich am politischen Prozess beteiligen. Die Arbeitswelt aber verhindert oft eine solche Partizipation. Der Philosoph Axel Honneth über ein unterbelichtetes Problem

Ist China totalitär?
Die Allgegenwart der Kommunistischen Partei legt den Verdacht nahe, dass es sich bei der Volksrepublik China um ein totalitäres System handelt. Doch für Hannah Arendt reicht das noch nicht.

Kohei Saito: „Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind das neue Opium des Volkes“
Mit seinem Entwurf eines Degrowth-Kommunismus ist Kohei Saito in Japan ein Überraschungsbestseller gelungen, der sich über 500.000 Mal verkauft hat. Im Interview erläutert der Philosoph, warum das Klima innerhalb des Kapitalismus nicht zu retten ist, weshalb wir nicht auf die Revolution warten sollten und was die Aktivisten der Letzten Generation von Karl Marx lernen können.
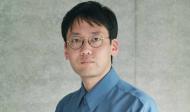
Die neue Sonderausgabe: Hegel
Hegel liefert keine leichten Antworten. Anstatt eines Entweder-oder ging es dem Philosophen der Dialektik darum, Widersprüche zusammenzudenken und aufzuheben – freilich ohne jemals alle Spannung einzuebnen. Das Denken bleibt also immer in Bewegung. Gerade in dieser Komplexität und Dynamik liegt der Reiz seiner Philosophie.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!

Die neue Feigheit
Derzeit ist ein Appell im Umlauf, der „das Denken aus dem Würgegriff“ befreien will und „die demokratischen Prozesse“ durch linken Gesinnungsterror in Gefahr sieht. Mit seinen Allgemeinplätzen verfehlt der Aufruf jedoch das eigentliche Problem, meint Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazin.

Das Gift ist die Botschaft
Dass Alexej Nawalny vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB vergiftet wurde, ist kaum noch zu bezweifeln. Doch warum sollte die russische Regierung einen Anschlag anordnen, der so deutlich auf sie zurückzuführen ist? Weil gerade das Gift selbst die Botschaft ist, wie ein Blick ins Werk des französischen Philosophen Gilles Deleuze verdeutlicht.
