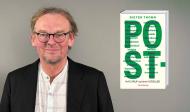Helmut Schmidt, der Weise
Helmut Schmidt ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben. In unserer Sommerausgabe Nr. 05/2015 porträtierten wir den großen Publizisten als distanzierten Denker, der alles erreicht hat. Ein Nachruf:
Vor ein paar Jahren veröffentlichten Helmut Schmidt und der amtierende Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo eine Reihe von Gesprächen unter dem Titel „Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt“. Das Büchlein, das ein Bestseller wurde, brachte den Stil der öffentlichen Interventionen, die der Altkanzler seit vielen Jahren pflegt und an die wir uns wie an eine überflüssige Instanz gewöhnt haben, auf den Punkt: Die Antworten, die er auf die Fragen di Lorenzos gibt, sind abwiegelnd, bisweilen unwirsch und selten mehr als ein paar Zeilen lang. Egal, welches Thema sein Gegenüber anschneidet: Schmidt wischt die steilen Thesen und die vermeintliche Hysterie zur Seite, redet Klartext und mahnt grummelnd zur Besonnenheit. Als „Ruhig-Blut-Appell“ hat ein Rezensent das Buch bezeichnet. Jeder Blick, den sein Autor in die Zukunft wirft, ist in die Vergangenheit gerichtet. Was auf uns zukommt, ist schon mal da gewesen. Zukunftsweisende Ziele hat so ein Mensch klarerweise nicht mehr. Wenn man Kategorien in Anschlag bringen will, könnte man damit sagen, Helmut Schmidt übt in unserer Medienlandschaft weniger die Funktion des Intellektuellen als die des Weisen aus.
Alexandre Kojève, der das 20. Jahrhundert im Licht von Hegel interpretierte, hielt die Weisheit für die zeitgemäße Form des Denkens. Als „absolutes Wissen“, wie es in Hegels „Phänomenologie des Geistes“ heißt, stelle sie die Verbindung von vollkommenem Selbstbewusstsein und vollkommener Zufriedenheit dar. Während der Intellektuelle das unglückliche Bewusstsein repräsentiere, das dem Menschen auf dessen Gang durch die Geschichte eigen gewesen sei, verkörpere der Weise die Überwindung dieser Diskrepanz von Geist und Welt in der Ära der Posthistoire. In Kojèves Augen gebührt Hegel das Verdienst, als Erster erkannt zu haben, dass mit Napoleon der epische Kampf der Menschen um Anerkennung abgeschlossen und die Ausbreitung des universalen Staates das einzig verbleibende historische Ereignis sei. Als Berater der Mächtigen übernehme der Weise die Aufgabe, zu dessen effizienterer Einrichtung beizutragen. Er ist der Denker, den sich eine Welt leisten kann, die keine Revolutionen mehr erwartet, weil alle Revolutionen schon geschehen sind.
Helmut Schmidt ist ein solcher Denker – auch wenn er kein geheimes Wissen, sondern sozialdemokratischen Common Sense bemüht und auch wenn die Posthistoire, aus der er zu uns spricht, mindestens ebenso eine biografische wie politische ist: Mit beinah hundert hat er alles erreicht, was man als Politiker in Deutschland erreichen kann, stellt sich keiner Wiederwahl und muss keine Delegierten mehr überzeugen. Seine Rolle, die ihm seine Präsenz in den Medien sichert, ist die des Elder Statesman, der ohne parteipolitische Verklausulierung sprechen kann. Nicht einmal auf seine Gesundheit muss er mehr Rücksicht nehmen. Daher ist er der Einzige, der im deutschen Fernsehen noch rauchen darf. Der Intendant, der ihm das verbieten wollte, würde vermutlich seinen Job verlieren. Obwohl die Souveränität, die der Patriarch mit Mentholzigarette verkörpert, von seiner Entmündigung ununterscheidbar ist: Lass den Opa doch rauchen, das schadet nicht. Dass Schmidt Karl Popper als seinen Lieblingsphilosophen bezeichnet, ist übrigens ein Missverständnis. Nichts könnte der Figur des Altkanzlers ferner sein, als Poppers Kernidee, dass sich jede Erkenntnis als falsch erweisen könnte. •
Weitere Artikel
Pathos der Nüchternheit. Zum Tod von Ernst Tugendhat
Ernst Tugendhat war einer der einflussreichsten Philosophen der Gegenwart. Am 13. März ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. In seinem Nachruf zeichnet Josef Früchtl Leben und Werk des ungewöhnlichen Denkers nach, dem es gelang, die analytische und traditionelle Philosophie zu verbinden.

Er irrte sich empor – Nachruf auf Hans Albert
Mit dem Philosophen und Soziologen Hans Albert ist einer der bedeutendsten Vertreter des Kritischen Rationalismus gestorben. Ein Nachruf.

Alain Froment: „Die Idee der Pflege ist ein tierisches Erbe“
Ein junger Mann auf der Insel Borneo (Indonesien) soll vor 31.000 Jahren erfolgreich amputiert worden sein. Dies geht aus einer Studie hervor, die kürzlich in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Der Anthropologe Alain Froment analysiert die Bedeutung dieser Entdeckung.

Helmuth Plessner und die Gemeinschaft
Am 12. Juni 1985 starb Helmuth Plessner. Scharfsinnig und stilistisch virtuos wendet er sich in seinem 1924 veröffentlichten Werk Grenzen der Gemeinschaft gegen den Wir-Kult, der damals die junge Demokratie der Weimarer Republik von rechter und linker Seite bedroht. Seine Verteidigung von Takt, Diplomatie und Höflichkeit gegen sämtliche Form von Unmittelbarkeitsbestreben ist noch immer aktuell.

Helmut Lethen: „Die kalte persona fühlt sich auf den Sammelplätzen gefährlichen Lebens wohl“
Der Krieg in der Ukraine bringt die „Verhaltenslehren der Kälte“ zurück: Ein Interview mit Helmut Lethen über Schmerz, Ernst Jünger als Avatar und täuschende Kulturattrappen.

Demokratie als Lebensform – Nachruf auf Oskar Negt
Am 2. Februar verstarb der Soziologe und Philosoph Oskar Negt. In seinem Nachruf erinnert sich Josef Früchtl an einen Menschen, der stets offen für Widerspruch blieb, und an einen Denker, der den Zusammenhang zwischen Politik und Gefühl ins Zentrum seines Schaffens stellte.

Catherine Colliot-Thélène. Nachruf auf eine kosmopolitische Denkerin
Catherine Colliot-Thélène war Philosophin, Weber-Kennerin und eine subtile Denkerin des Kosmopolitismus. Am 6. Mai ist sie gestorben.

Kulturanzeiger – Dieter Thomä: „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“
In unserem Kulturanzeiger stellen wir in Zusammenarbeit mit Verlagen ausgewählte Neuerscheinungen vor, machen die zentralen Ideen und Thesen der präsentierten Bücher zugänglich und binden diese durch weiterführende Artikel an die Philosophiegeschichte sowie aktuelle Debatten an. Diesmal im Fokus: Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe von Dieter Thomä, erschienen bei Suhrkamp.