Haben wir moralisch versagt?
Dass die Menschheit sich gewissenlos gegenüber der Natur verhalte, ist eine weit verbreitete Auffassung. Aber ist sie auch wahr und nützlich? Eine Intervention von Michael Hampe.
Liegt der ökologischen Krise moralisches Versagen zugrunde? Aussagen wie „Die Menschen haben die Kontrolle verloren“ und handelten „gewissenlos“ (so Tina Baier in der Süddeutschen Zeitung vom 23.06.), findet man immer wieder, wenn es um die anthropogene Klima-Erwärmung und das Artensterben geht: So, wie verantwortungslose Personen salziges Abwasser in die Oder geleitet und dadurch im August 2022 ein massenhaftes Fischsterben in dem immer noch versalzten Fluss verursacht haben, gehen Menschen vermeintlicher Weise auch „mit dem ganzen Planeten um“: „gewissenlos“. Menschen „haben nicht im Griff“, was auf der Welt als Konsequenzen ihres Handelns geschieht. Ja, sie kümmern sich gar nicht um die Konsequenzen ihrer Taten. Deshalb versagen sie moralisch. Aber hatten sie „es“, gar die Welt als ganze je „im Griff“? Hat sich moralisch etwas verändert oder nur Reichweite der Folgen ihres Handelns aufgrund gesteigerter Macht?
Sollten wir uns schämen?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Michael Hampe: „Es ist sinnlos zu fragen, was der Zweck des ganzen Lebens ist“
Unsere Existenz ist meist ausgerichtet: Es gilt, sich anzustrengen, ein Ziel zu verfolgen, einen Erfolg einzufahren. Doch das, so Michael Hampe, führt in die geistige Enge und lässt die Wahrnehmung verarmen. Wie lässt sich ein Leben jenseits von Zwecksetzungen vorstellen? Und was wird aus der Moral, wenn wir uns von Bewertungen verabschieden?

Michael Hampe: "Expertenherrschaft ist der Tod der Demokratie"
Dem amerikanischen Pragmatismus haftet bis heute der Makel des Kosten-Nutzen-Denkens an. In Wirklichkeit will er die Menschen zu neuen Erfahrungen führen. Der Philosoph Michael Hampe über Trump, Brexit und die Notwendigkeit einer pragmatischen Utopie.
Michael Hampe: "Wir brauchen keine Experten der Vernünftigkeit"
Ist die Welt dafür geschaffen, in ihr glücklich zu werden? Woran erkennt man ein gelingendes Leben? In seinen Werken entwirft Michael Hampe ein neues Selbstverständnis der Philosophie als Lebenskunst. Ein Gespräch über falsche Erkenntnisideale, musizierende Sokratiker und die letzte Weisheit des Buddha
Vom Anfang und Ende des Bewusstseins
In seiner Philosophie der Zwecklosigkeit lässt Michael Hampe den Druck des Nützlichen verschwinden – und findet zu eindrucksvollen Sprachbildern.
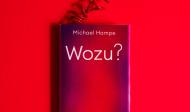
Ja statt Nein!
In der Unfähigkeit zum Ja offenbart das Nein seine Schwäche, die verbreiteter ist, als man denken möchte. Eine Intervention von Svenja Flaßpöhler.

Wer sind "Wir"?
Als Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das!“ aussprach, tat sie dies, um die Deutschen zu einer anpackenden Willkommenskultur zu motivieren. Aber mit der Ankunft von einer Million Menschen aus einem anderen Kulturkreis stellt sich auch eine für Deutschland besonders heikle Frage: Wer sind wir eigentlich? Und vor allem: Wer wollen wir sein? Hört man genau hin, zeigt sich das kleine Wörtchen „wir“ als eine Art Monade, in der sich zentrale Motive zukünftigen Handelns spiegeln. Wir, die geistigen Kinder Kants, Goethes und Humboldts. Wir, die historisch tragisch verspätete Nation. Wir, das Tätervolk des Nationalsozialismus. Wir, die Wiedervereinigten einer friedlichen Revolution. Wir, die europäische Nation? Wo liegt der Kern künftiger Selbstbeschreibung und damit auch der Kern eines Integrationsideals? Taugt der Fundus deutscher Geschichte für eine robuste, reibungsfähige Leitkultur? Oder legt er nicht viel eher einen multikulturellen Ansatz nahe? Offene Fragen, die wir alle gemeinsam zu beantworten haben. Nur das eigentliche Ziel der Anstrengung lässt sich bereits klar benennen. Worin anders könnte es liegen, als dass mit diesem „wir“ dereinst auch ganz selbstverständlich „die anderen“ mitgemeint wären, und dieses kleine Wort also selbst im Munde führen wollten. Mit Impulsen von Gunter Gebauer, Tilman Borsche, Heinz Wismann, Barbara Vinken, Hans Ulrich Gumbrecht, Heinz Bude, Michael Hampe, Julian Nida-Rümelin, Paolo Flores d’Arcais.
Wie werde ich weise?
Je mehr Entscheidungen uns abgerungen werden, desto größer wird die Sehnsucht nach einem tiefen Wissen, das uns das Richtige tun lässt: nach Weisheit. Die Kulturanthropologin Aleida Assmann und der Philosoph Michael Hampe ergründen eines der ältesten Konzepte der Menschheit.

Michael Butter: „Früher stellten Verschwörungstheorien eine anerkannte Form des Wissens dar“
Verschwörungstheorien scheinen dieser Tage allgegenwärtig. Der Literaturwissenschaftler Michael Butter erläutert im Gespräch, warum sie in der Vergangenheit jedoch viel verbreiteter waren, weshalb sie gerade in der Aufklärung Konjunktur hatten und wie man im persönlichen Umfeld auf sie reagieren sollte.

Kommentare
Für eine umfassendere Weltregierung bräuchte es vielleicht eine Weltregierungsform. Im Moment, lese ich, leistet Demokratie mancherorts Dinge, die Diktatur kaum kann und andernorts anders herum. So lehnen wohl viele Nationen Weltparlament über die UNGA hinaus ab und andere Weltdiktatur. Zweiparteiensysteme mit zwei universellen Parteikonzepten schätze ich vielleicht hilfreich. Einfachheit der Diktatur und Pluralismus der Demokratie schätz ich da wahrscheinlich beide relativ gut verwirklicht.
Dann wird vielleicht auch der Klimawandel globaler betrachtet und behandelt.
Ich danke für den Artikel und die Möglichkeit, zu kommentieren.