Eine andere KI ist möglich
Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz verblüffen, werfen aber auch die Frage auf, wozu die Technologie eigentlich dienen soll. In den 1970er-Jahren träumten Hippie-Informatiker von Maschinen, die die menschliche Intelligenz fördern und die Welt besser machen sollten. Über einen nicht beschrittenen techno-utopischen Weg.
Ein Gespenst geht um in Amerika: das Gespenst des Kommunismus. Aber diesmal kommt es digital daher. Daron Acemo lu, Ökonom am Massachusetts Institute of Technology (MIT), stellt eine provozierende Frage: „Würde ein KI-gesteuerter Kommunismus funktionieren?“ Der Risikokapital-Unternehmer Marc Andreessen bangt: „Wird China eine kommunistische KI entwickeln?“ Das Ratespiel macht sogar Vivek Ramaswamy mit. Der Trump-Anhänger und Geschäftsfreund von Donald Trumps Vizekandidaten J. D. Vance verkündet auf X, eine prokommunistische künstliche Intelligenz sei so gefährlich wie Corona.
Bei der ganzen Panikmache bleibt allerdings völlig unklar, was mit einer „kommunistischen KI“ gemeint sein soll. Hat man eine Entwicklung vor Augen, die dem chinesischen Tech-Modell folgt, mit Plattformen nach dem Vorbild US-amerikanischer Konzerne, die aber strenger staatlicher Kontrolle unterliegt? Oder eine Version, die sich am europäischen Sozialstaatsmodell orientiert, mit einer Konzentration der KI-Entwicklung in öffentlichen Institutionen?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Ausgabe: Macht künstliche Intelligenz uns freier?
Unter Hochdruck wird daran gearbeitet, Maschinen das Denken beizubringen. Doch womit haben wir es tatsächlich zu tun, wenn wir von „künstlicher Intelligenz“ sprechen? Wie transformiert diese Technologie unser Begehren, die Arbeitswelt, den Krieg? Wo sind Gefahren zu bannen, wo Freiheiten zu entdecken?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
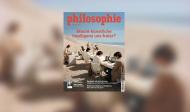
Wo ist das Kind, das ich war?
Eine unheimliche Erfahrung. Dieser Mensch auf dem Foto, der mit Zahnlücke in die Kamera lächelt, das soll einmal ich gewesen sein? Mit allen seinen überschüssigen Träumen, Ambitionen, Fragen und Plänen? Fast unmöglich, ein geklärtes Verhältnis zu den eigenen Anfängen zu finden. Jenseits von Nostalgie und romantischer Verklärung. Aber auch frei von der Illusion, die biografische Vergangenheit ganz hinter sich lassen zu können. Während die einen die Infantilisierung der Gesellschaft beklagen, fordern andere eine heilende Rückkehr zum inneren Kind. Ist der Weg ins Erwachsenenleben notwendig der einer Desillusion und Selbstentfremdung? Und was könnte das überhaupt heißen: erwachsen sein? Ein Dossier über eine Frage, die sich jeder stellen muss.
Kann man Leben künstlich erzeugen?
Bereits Schüler experimentieren heute mit Genbaukästen, Forscher dringen immer tiefer in die Geheimnisse der DNA ein, kreative Eingriffe auch in das menschliche Genom sind keine Zukunftsmusik mehr. Die Fortschritte der synthetischen Biologie wecken nicht nur ethische Bedenken. Sie zwingen uns auch, neu über die Frage nachzudenken, was Leben eigentlich ist – und wo die Grenze zur toten Materie liegt. Reportage aus den Zukunftslaboratorien unseres Zeitalters.

LaMDA – von Chatbots und Engeln
Der Google-Mitarbeiter Blake Lemoine behauptete jüngst, dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt hätte. Möglich, meint der Philosoph Stefan Lorenz Sorgner, im Hinblick auf neue Technologien aber nicht die entscheidende Frage.

Ferien vom Realitätsprinzip: „Die Durrells auf Korfu“
Die Serie Die Durrells auf Korfu ist derzeit in der Arte-Mediathek zu sehen. Mit sprühendem Witz erzählt sie vom Leben der exzentrischen Familie auf der griechischen Insel. Dabei scheint eine undogmatische Form des Utopischen auf.

Der Mensch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz
Der Fortschritt auf dem Gebiet der KI erobert immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens. Auf der Phil.COLOGNE loten Daniel Kehlmann und Markus Gabriel diese Entwicklung aus: Was lässt sich mit Hegel über die Denkfähigkeit von KI sagen? Ist ChatGPT in der Lage zu verstehen? Und: Kann KI uns möglicherweise Wesentliches lehren – nämlich Nichtmenschliches mit Respekt zu behandeln?

Jörg Noller „Digitale Technologien sind weder Objekt noch Subjekt“
Wie hätte Hegel auf den heutigen Stand der Technik geblickt? Der Philosoph Jörg Noller erläutert, warum künstliche Intelligenz nicht zu dialektischem Denken fähig ist, und wohin der Weltgeist steuern könnte, wenn das Metaverse Wirklichkeit wird.

Umkämpfte Gehirne – brauchen wir Neurorechte?
Die Fortschritte der Neurotechnologie könnten es in Zukunft ermöglichen, Gedanken zu überwachen und zu steuern. Manche fordern daher „Neurorechte“, die unsere „mentale Integrität“ schützen. Doch bei der Formulierung solcher Rechte stellen sich grundlegende philosophische Fragen über die Natur von Gehirn und Geist.
