Hört her, ihr Affen!
Aristoteles definiert den Menschen in Abgrenzung vom Tier. Kafkas Bestiarium bringt dieses menschliche Selbstverständnis gehörig ins Wanken. Insekten, Affen, Pferde, Mäuse sind Bedeutungsträger, Subjekte, Projektionen – und halten uns auf unbequeme Weise den Spiegel vor.
Es wimmelt, wuselt, krabbelt, klettert, galoppiert. Lässt man das Personal von Kafkas Kurzprosa in der geistigen Manege Revue passieren, fällt umgehend auf, wie prominent nicht-menschliche Tiere darin vertreten sind. Der Hund etwa, den der Junggeselle Blumfeld aus der gleichnamigen Erzählung sich anzuschaffen gedenkt, damit er im Alter Gesellschaft hat. Die Flöhe, die so ein Hund unweigerlich mit nach Hause schleppen würde – eine Vorstellung, die Blumfeld umgehend wieder von seinem Plan abbringt. Die Schädlinge im Pelzkragen des Türhüters, mit denen der Mann vom Lande aus der Parabel Vor dem Gesetz Bekanntschaft schließt und die er zu seinen Gunsten zu beeinflussen versucht. Das Ungeziefer aus der Verwandlung natürlich, der gelehrte Schimpanse Rotpeter aus dem Bericht für eine Akademie, der dachsähnliche Eigenbrötler aus dem Fragment Der Bau, die singende (oder womöglich doch nur piepsende) Maus Josefine: Es ist ein gewaltiges, verschiedenste Arten umfassendes Bestiarium, das Kafkas Werk entwirft. Wollte man die darin auftretenden Tiere kategorisieren, könnte man höchstens sagen: Sie gehören zur Familie der „Kafkanidae“ – eine Ordnung, die es nur im Werk dieses Autors gibt.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Väterliche Schöpfungskraft
Jüngst gelang es japanischen Forschern erstmals, Mäuse mit zwei genetischen Vätern zu zeugen: Die Wissenschaftler wandelten Hautzellen männlicher Mäuse in Eizellen um, befruchteten diese mit Spermien anderer Mäuse und ließen die Embryos von einer weiblichen Leihmutter austragen.

"Auch Insekten haben einen moralischen Status"
Eine Studie der Radboud University in Nijmegen zeigt, dass die Biomasse von Insekten um 76 Prozent zurückgegangen ist. Wie das unser Verhältnis zur Umwelt verändert, erklärt der Philosoph Martin Gorke
Der Sturz des Tyrannen
Der Ukrainekrieg bringt Putins Herrschaft ins Wanken. René Schlott zeigt, was uns Platon und Aristoteles über das unausweichliche Schicksal des Tyrannen lehren.

Dirk Oschmann: „Was mit Freiheit zu gewinnen wäre, bleibt unklar“
Das Versprechen der Freiheit ist ein zentraler Baustein der Moderne. In Kafkas Romanen zeigt sie dagegen ihre Schattenseite, erklärt Dirk Oschmann. Ein Gespräch über das Vertrautsein mit der Welt, Amerika als Strafkolonie und Kafkas „Stufen der Scheinbarkeit“.

Aristoteles und die Seele
In seiner wirkmächtigen Abhandlung Über die Seele behauptet Aristoteles: Die Seele ist kein Körper, aber sie existiert auch nicht ohne ihn. Ja, was denn nun, fragen Sie sich? Wir helfen weiter!

Rechtsleere
Advokaten, Richter und Beamte bevölkern Kafkas Universum. So detailliert der moderne Rechtsstaat aber auch beschrieben wird, so unklar bleibt seine innere Funktionsweise. Besteht gerade darin Kafkas Rechtskritik?

Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
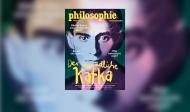
Problematische Projektionen
Viele Nationen betrachten den Nahostkonflikt vor dem Hintergrund eigener historischer Schuld. Das muss den Blick jedoch nicht zwangsläufig verzerren, meint Robert Ziegelmann. Mithilfe von Marx, Adorno und Horkheimer lassen sich bessere von schlechteren Projektionen unterscheiden.
