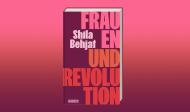Olga Shparaga: „Menschen werden Bürger“
Seit Wochen demonstrieren hunderttausende Menschen in Belarus gegen den autokratischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Philosophin Olga Shparaga ist Teil des oppositionellen Koordinationsrates und wurde am 04.10. für einen Tag verhaftet. Am 08.10. sprach sie mit uns über ihre Erfahrungen im Gefängnis und erklärte, wie sich in Belarus gerade eine „Demokratie von unten“ entwickelt. Am 09.10. wurde Shparaga zu einem Polizeiverhör geladen und am 12.10. schließlich zu 14 Tagen Arrest verurteilt. Ihr Aufenthaltsort ist gegenwärtig unbekannt und ihr Anwalt wird nicht zu ihr gelassen.
Philosophie Magazin: Sie wurden am 4. Oktober während einer Demonstration festgenommen und verbrachten eine Nacht im Gefängnis. Wie lief Ihre Verhaftung ab?
Olga Shparaga: Wir, mein Mann Alexander Adamiants und ich, haben seit den gefälschten Wahlen vom 9. August an allen Demonstrationen teilgenommen. Langsam macht sich eine gewisse Müdigkeit breit, da Alexander Lukaschenko sich weiterhin an die Macht klammert. Dennoch ist die Entschlossenheit, unsere demokratischen Rechte einzufordern, nicht geschwunden – ganz im Gegenteil. An dem besagten Tag gelang es der Polizei, eine kleine Gruppe von Demonstranten zu isolieren, in der auch wir uns befanden. Plötzlich sprangen maskierte Männer aus Lieferwagen und begannen protestierende Demonstranten festzunehmen. Sie gehen dabei hauptsächlich gegen Männer vor, aber als ich mich einmischte, weil sie meinen Mann mitnahmen, verhafteten sie auch mich. Während der Fahrt zur Polizeistation und dann später zum Gefängnis verhielten sich die Sicherheitskräfte uns gegenüber wie Kriminelle. Sie riefen„Hände hinter den Rücken“, „Schau mich nicht an“, und beschimpften uns. Einige Polizisten waren auch sehr brutal und schlugen die Männer. Ein Beamter legte sogar die rot-weiße belarussische Flagge, das Symbol der demokratischen Revolution, auf den Boden und zwang uns, darauf zu treten. Dabei trugen die Sicherheitskräfte die ganze Zeit Sturmhauben. Und man fragt sich: Wer hat hier am Ende vor wem Angst? Wenn sie keine Angst vor uns haben, warum tragen sie dann Masken?
Wie erlebten Sie die Nacht im Gefängnis?
Für mich war es das erste Mal, dass ich mich in einem Gefängnis befand. Es war eine sehr wichtige Erfahrung, um zu verstehen, was inhaftierte Menschen während dieser Revolution durchmachen. Ich hatte mich darauf vorbereitet, indem ich etwa einen Kapuzenpullover trug, sodass ich nicht allzu sehr fror. Ich war mit drei anderen Frauen in einer Zelle. Es war unmöglich zu schlafen, da ein höllischer Lärm herrschte. Am nächsten Morgen, nachdem wir gegen 6 Uhr aufgewacht waren, mussten wir sehr lange warten.
Zu was wurden Sie verurteilt?
Zu gar nichts! Ich weiß nicht, warum man mich laufen ließ, während andere zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt wurden. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass mein Mann und ich einen Anwalt hatten, der sich bei den Behörden meldete. Wir hofften die ganze Zeit nur, dass sie nicht herausfinden, dass ich Mitglied des oppositionellen Koordinierungsrates bin. Womöglich lassen sich die unterschiedlichen Behandlungen aber auch mit Zufall und dem desorganisierten Charakter repressiver Strukturen erklären.
Im August gab es Berichte über massive Folter in den Haftanstalten. Findet die nicht mehr statt?
Die Folterpraktiken, die vor allem zwischen dem 9. und 11. August angewendet wurden, führten zu einer starken Mobilisierung innerhalb der Gesellschaft. Alle, die sich über den Wahlbetrug empörten, ihren Zorn aber noch nicht offen zeigten, gingen nach den Nachrichten über die Folter auf die Straße. Solch systematische Folter wird nicht mehr angewendet. Als Mitglied einer Arbeitsgruppe für politische Gefangene erhalte ich aber Informationen über Ad-hoc-Folterungen, die sich insbesondere gegen jene richten, auf die das Regime besonders wütend ist. Die Folter ist daher nicht verschwunden.
Wie erklären Sie sich, dass eine Gesellschaft, die gegenüber dem Regime lange relativ passiv war, nun gegen die Machthaber aufsteht.
Das ist das Ergebnis eines langen gesellschaftlichen Bewusstseinsprozesses. Vor den Wahlmanipulationen im August spielte etwa die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine wichtige Rolle. Diese legte die Widersprüche des belarussischen Regimes offen. Lukaschenko hat sich immer auf die Idee eines starken Wohlfahrtsstaates gestützt, der die Menschen schützt. Dann leugnete er jedoch die Gefahr des Virus. Er verhielt sich verächtlich gegenüber den Menschen und gab allein ihnen die Schuld, dass das Virus sich verbreitete. Dadurch wurde das Versagen des Staates allzu deutlich. Selbst den Frauen, die Lukaschenko unterstützten, wurde nun klar, dass sie bei der Bekämpfung der Pandemie allein gelassen werden – insbesondere im Pflegebereich.
Stimmt es also, dass die belarussische Gesellschaft begonnen hat, sich selbst zu organisieren, um sich besser vor Covid-19 zu schützen?
Ja, und die Menschen haben dabei erkannt, dass sie viele Probleme selbst lösen können. Überall herrschte immense Solidarität. Ärzte, die die Ablehnung von Patienten in staatlichen Krankenhäusern anprangerten und daraufhin entlassen wurden, bekamen Unterstützung durch Solidaritätsfonds. Zur Versorgung von Covid-19-Patieten besorgten sie sich so selbst Atemschutzmasken und medizinische Ausrüstung.
Wie lässt sich der derzeitige Aufstand der Belarussen gegen eine seit 26 Jahren bestehende Herrschaft philosophisch deuten?
Um im Vokabular Hannah Arendts zu sprechen: Wir erleben gerade eine Revolution, Menschen werden Bürger. Letztere wollen sich nicht mehr nur mit ihren privaten Angelegenheiten befassen, sondern sich mit Fragen beschäftigen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen. Unsere Revolution ist von Grund auf demokratisch. Die Worte, die ich am meisten gehört habe, seitdem drei Frauen sich entschieden hatten, gegen Alexander Lukaschenko zu kandidieren, waren: faire Wahlen, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Verfassung. Unsere Revolution ist zudem von Grund auf republikanisch, weil sie weniger auf dem Konzept der Nation, als vielmehr auf dem der öffentlichen Sache, der „res publica“ basiert. Die Menschen wollen keine Subjekte mehr sein, über die nur der Staat entscheidet. Sie sind bereit, die Verantwortung für die Führung des Landes selbst zu übernehmen.
Und da Alexander Lukaschenko sich weigert, die Macht zu abzugeben, organisiert die Gesellschaft sich eben einstweilen selbst …
Die Bürger überwinden zunächst viele Gegensätze. Einige sprechen Weißrussisch, andere Russisch. Einige sind religiös, andere nicht. Aber die Idee, dass das Recht triumphieren muss, vereint jetzt alle. Selbst in einer undemokratischen Gesellschaft wie der unsrigen können die Menschen debattieren. Das sind echte demokratische Fähigkeiten, die sich in der Gesellschaft entwickeln. So erleben wir tatsächlich die Geburt einer Demokratie von unten. Die Bürger wollen ihre Probleme jetzt selbst lösen. In Schulen protestieren viele Eltern beispielsweise gegen die Pflichtkurse in nationaler Ideologie. Sie drohen den Lehrern, ihre Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken. Und das funktioniert. Es gibt plötzlich Kompromisse, die Lehrer akzeptieren, dass Kinder von diesen Kursen ausgenommen sind oder sich während des Unterrichts mit anderen Themen befassen. Dass die Eltern mitreden können, so etwas gab es vorher nicht. Die Gesellschaft schafft sich Instrumente der Machtkontrolle.
Innerhalb einer Diktatur entsteht also gerade eine partizipative Demokratie?
So ist es tatsächlich, ja. Die Menschen machen sich aber auch mit den Mitteln der repräsentativen Demokratie vertraut. Sie interessieren sich für Entscheidungsprozesse, sehen, was funktioniert und was nicht, was nützlich ist und was nicht. Sie verstehen, auf wen sie tatsächlich Druck ausüben können, um ein Ergebnis zu erzielen. Zum Beispiel verspricht Alexander Lukaschenko nun eine Verfassungsreform. Gruppen von Bürgern, die ihm das natürlich nicht abnehmen, nehmen ihn dennoch beim Wort, indem sie ihre Vorschläge elektronisch einreichen, nur damit deutlich wird, dass der Staat sie nicht berücksichtigen wird. So ist zumindest alles dokumentiert!
Wie blicken Sie in die Zukunft?
Es ist schwer zu sagen, wie diese Krise gelöst werden wird. Was jedoch offensichtlich ist: Das Erwachen der Zivilgesellschaft hat einen No-Return-Effekt erzeugt. Die Gesellschaft hat sich ein für alle Mal verändert. Im Zuge der Selbstorganisation werden sicher auch Fehler gemacht werden. Doch die Entfesselung dieser sozialen Energien wird früher oder später zum Ende des Autoritarismus führen. •
Die Philosophin Olga Shparaga ist Autorin mehrerer Bücher über politisches Denken, Feminismus sowie Kunstphilosophie und lehrt seit mehreren Jahren am „European College of Liberal Arts in Belarus“, einer staatlich unabhängigen Universität in Minsk. Sie ist Mitglied des Koordinierungsrates der Opposition, des belarussischen PEN-Zentrums sowie des unabhängigen Belarussischen Journalistenverbands (BAZh). Nach den Wahlfälschungen am 9. August setzt sie sich für einen demokratischen Übergang in Belarus ein und wir seitdem politisch verfolgt.
Weitere Artikel
Ende der Secondhand-Zeit
Jahrzehntelang war Belarus erstarrt in einer patriarchalen Sowjetfiktion. Aufgebrochen wurde sie maßgeblich durch weiblichen Widerstand gegen Präsident Lukaschenko.

Sadik al Azm: „Syrien erlebt die Revolution in der Revolution“
Seit fast sechs Jahren wütet in Syrien ein brutaler Bürgerkrieg, in dem bis zu 500 000 Menschen getötet wurden, während Millionen zur Flucht innerhalb und außerhalb des Landes gezwungen wurden. Das Regime von Baschar al Assad und eine unübersichtliche Mischung von oppositionellen Kräften und IS-Milizionären bekämpfen einander und die Zivilbevölkerung rücksichtslos. Vor vier Jahren sprach das Philosophie Magazin mit Sadik al Azm, einem der bedeutendsten Philosophen des Landes, der kurz zuvor nach Deutschland emigriert war, über die Aussichten für Syrien, das Gespräch führte Michael Hesse. Al Azm ist am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, in Berlin gestorben.

Die neue Sonderausgabe: Der Schlaf. Das unbekannte Drittel unseres Lebens
Philosophen von Heraklit über Hegel bis zu Jean-Luc Nancy haben die vielschichtige Bedeutung des Schlafs ergründet. Der Schlaf, so zeigt dieses Heft, ist das unabdingbare Andere von Bewusstsein, Vernunft und Willenskraft, die ohne Gegengewicht unerträglich und irrational werden. Der Schlaf erhält das Lebendige, lässt uns lernen und träumen. Zeit, das unbekannte Drittel unserer Existenz zu entdecken.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!

Wo endet meine Verantwortung?
Erinnern Sie sich noch an Reem? Reem Sahwil ist das palästinensische Mädchen, dem Bundeskanzlerin Merkel vor knapp einem Jahr im Rahmen eines Bürgerdialogs erklärte, dass seine aus dem Libanon eingereiste Familie kein Bleiberecht in Deutschland erhalten werde, da der Libanon keine Kriegszone sei und Deutschland aus den dortigen Lagern schlicht nicht alle Menschen aufnehmen könne. Noch während Merkel ihre Begründung ausführte, fing Reem bitterlich zu weinen an. Die Kanzlerin stockte, ging darauf in einer Art Übersprunghandlung auf das im Publikum sitzende Mädchen zu und begann es zu streicheln, weil, wie Merkel, noch immer mit dem Mikro in der Hand, erklärte, „weil ich, weil wir euch ja nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast“.
Das Paradox der Menschenrechte
Tausende Menschen harren an der belarussisch-polnischen Grenze aus. An ihnen offenbart sich, was Hannah Arendt bereits 1949 erkannte: Die vermeintlich universalen Menschenrechte können gerade diejenigen nicht schützen, die sie am dringendsten brauchen.

Gefangen im Dilemma?
Erinnern Sie sich noch an Reem? Reem Sahwil ist das palästinensische Mädchen, dem Bundeskanzlerin Merkel vor knapp einem Jahr im Rahmen eines Bürgerdialogs erklärte, dass seine aus dem Libanon eingereiste Familie kein Bleiberecht in Deutschland erhalten werde, da der Libanon keine Kriegszone sei und Deutschland aus den dortigen Lagern schlicht nicht alle Menschen aufnehmen könne. Noch während Merkel ihre Begründung ausführte, fing Reem bitterlich zu weinen an. Die Kanzlerin stockte, ging darauf in einer Art Übersprunghandlung auf das im Publikum sitzende Mädchen zu und begann es zu streicheln, weil, wie Merkel, noch immer mit dem Mikro in der Hand, erklärte, „weil ich, weil wir euch ja nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast“.

Rache ohne Reue?
Seit 23 Jahren sitzt Giuseppe Grassonelli als Kopf eines Rachefeldzugs gegen die Cosa Nostra hinter Gittern. Da er eine Kronzeugenregel ablehnte, wird der mehrfache Mörder das Gefängnis nie wieder verlassen. Im Verlauf der Haft entdeckte der Sizilianer die Philosophie für sich, begann ein Studium, schloss es mit Auszeichnung ab. Wir haben Grassonelli, der lange Jahre in Hamburg lebte, im Gefängnis getroffen: Wie denkt er heute über seine Vergangenheit? Treffen mit einem Menschen, dem der Dialog mit Hegel und Nietzsche wichtiger wurde als alles andere
Leseprobe aus „Frauen und Revolution“
Vom Iran bis Belarus, von Fridays for Future bis zu den großen Diskriminierungsdebatten – Revolutionen und gesellschaftliche Wandlungsprozesse haben heute oft ein weibliches Gesicht. Ausgehend von den mutigen Frauen im Iran fragt die vielfach ausgezeichnete Journalistin Shila Behjat nach den Besonderheiten weiblichen Protests.