Afterbild der Erziehung
Viel wurde über die Auswirkung der Schulschließung auf die Kinder diskutiert. Aber was soll Bildung leisten? Friedrich Nietzsche war überzeugt: Es geht nicht um Faktenwissen.
„Deine wahren Erzieher und Bildner verraten dir, was der wahre Ursinn und Grundstoff deines Wesens ist, etwas durchaus Unerziehbares und Unbildbares, aber jedenfalls schwer Zugängliches, Gebundenes, Gelähmtes: deine Erzieher vermögen nichts zu sein als deine Befreier. Und das ist das Geheimnis aller Bildung: sie verleiht nicht künstliche Gliedmaßen, wächserne Nasen, bebrillte Augen – vielmehr ist das, was diese Gaben zu geben vermöchte, nur das Afterbild der Erziehung. Sondern Befreiung ist sie, Wegräumung alles Unkrauts, Schuttwerks, Gewürms, das die zarten Keime der Pflanzen antasten will, Ausströmung von Licht und Wärme, liebevolles Niederrauschen nächtlichen Regens, sie ist Nachahmung und Anbetung der Natur, wo diese mütterlich und barmherzig gesinnt ist, sie ist Vollendung der Natur, wenn sie ihren grausamen und unbarmherzigen Anfällen vorbeugt und sie zum Guten wendet, wenn sie über die Äußerungen ihrer stiefmütterlichen Gesinnung und ihres traurigen Unverstandes einen Schleier deckt. Gewiss, es gibt wohl andre Mittel, sich zu finden, aus der Betäubung, in welcher man gewöhnlich wie in einer trüben Wolke webt, zu sich zu kommen, aber ich weiß kein besseres, als sich auf seine Erzieher und Bildner zu besinnen. (…) Wenn ich früher recht nach Herzenslust in Wünschen ausschweifte, dachte ich mir, dass mir die schreckliche Bemühung und Verpflichtung, mich selbst zu erziehen, durch das Schicksal abgenommen würde: dadurch, dass ich zur rechten Zeit einen Philosophen zum Erzieher fände (…).“
Friedrich Nietzsche, „Unzeitgemäße Betrachtungen III: Schopenhauer als Erzieher“ (1874)
Weitere Artikel
Schule der Angst
Die langen Schulschließungen waren ein Irrtum mit gravierenden Folgen. Die Fehler müssen aufgearbeitet werden, damit die Kinder ihren Weg in die Mündigkeit finden, argumentiert Politiklehrer Robert Benkens.

Friedrich Nietzsche und die Geschichte
Für Friedrich Nietzsche fußte der Umgang mit der Geschichte auf der Fähigkeit, „eine monumentalische, eine antiquarische und eine kritische Art der Historie zu unterscheiden“. Was das bedeuten soll? Wir klären auf!

Kant, Nietzsche und Hegel über den Krieg
Wie hätten sich die drei Philosophen Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche und Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Krieg in der Ukraine verhalten? In seinem fiktionalen Bargespräch lässt Alexandre Lacroix die drei Geistesgrößen in Königsberg aufeinandertreffen.

Machen Krisen uns stärker?
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, formuliert Friedrich Nietzsche. Aber woran entscheidet sich, ob wir an Schicksalsschlägen scheitern – oder reifen? Was unterscheidet gesunde Widerständigkeit von Verdrängung und Verhärtung? Machen Krisen kreativer? Ermöglichen allein sie wahre Selbstfindung? Oder wären solche Thesen bereits Teil einer Ökonomisierung des Daseins, die noch in den dunkelsten Stunden unserer Existenz nach Potenzialen der Selbstoptimierung fahndet?
Wolfram Eilenberger legt mit Nietzsche frei, wie man existenzielle Krisen nicht nur überleben, sondern für sich nutzen kann. Ariadne von Schirach singt dagegen ein Loblied auf den Menschen als ewiges Mangelwesen, und im Dialog mit dem Kulturtheoretiker Thomas Macho sucht Roger Willemsen nach dem Gleichgewicht zwischen beschädigter Existenz und Liebe zur Welt.
Warum Taylor Swift?
Taylor Swifts Texte werden bald in Harvard diskutiert, ihre Konzerte haben Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistungen ganzer Länder und jüngst ließen ihre Fans sogar die Erde beben. Doch was macht die Künstlerin eigentlich so faszinierend?

Nietzsche im Home-Gym
Seit dem Beginn der Pandemie liegt das Wohnzimmer-Workout voll im Trend. Hätte auch Friedrich Nietzsche den Laptop aufgeklappt und zu den Gewichten gegriffen? Sicherlich nicht, denn der Fitnesskampf mit sich selbst wäre für ihn nur eine „halbe Sache“.

Christiane Tietz: „Man kann den ,Zarathustra' gar nicht richtig verstehen, wenn man sich nicht in der Bibel auskennt“
Am 25. August ist der 125. Todestag Friedrich Nietzsches, dem Urheber des berühmten Satzes: „Gott ist tot“. Wie hat das Christentum Nietzsches Denken geprägt? Und was bleibt heute von seiner Religionskritik? Ein Gespräch mit Theologin und Kirchenpräsidentin Christiane Tietz.
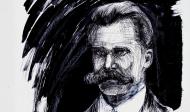
Martin Luther und die Angst
Sein kultureller Einfluss ist nicht zu überschätzen: Martin Luthers Bibelübersetzung bildet den Anfang der deutschen Schriftsprache, seine religiösen Überzeugungen markieren den Beginn einer neuen Lebenshaltung, seine theologischen Traktate legen das Fundament einer neuen Glaubensrichtung. In der Lesart Thea Dorns hat Luther, der heute vor 479 Jahren starb, die Deutschen aber vor allem eines gelehrt: das Fürchten. Oder präziser: die Angst. In ihrem brillanten Psychogramm des großen Reformators geht die Schriftstellerin und Philosophin den Urgründen von Luthers Angst nach – und deren uns bis heute prägenden Auswirkungen.
