Was tun, Hannah?
Nr. 85 - Dezember / Januar
Die Herausforderungen der Gegenwart sind groß. Grund genug, Rat bei einer Denkerin zu suchen, die viele unserer Problemlagen in Extremform kannte und dennoch nie die Zuversicht verlor. Stattdessen schuf sie eine Philosophie des Handelns und forderte von Bürgerinnen und Bürgern Mut, geistige Autonomie und die Fähigkeit politischer Urteilskraft. Ein Dossier über Hannah Arendt und die Möglichkeit eines Neubeginns, der in uns allen wohnt.
Alle Texte in der Übersicht
Dossier: Was tun, Hannah?
Die Denkerin der Stunde
Hannah Arendts Einfluss in Philosophie, Geschichts- und Kulturwissenschaften ist immens und die politische Theorie sind quasi Arendt Studies. Das verdankt sich nicht nur den Themen, die Arendt behandelte, sondern auch ihrem besonderen Denkstil.

Arendts Welt
Dass es Wahrheit nur zu zweien gibt, ist ein Leitspruch, den Arendt auch für ihr eigenes Leben beherzigt hat. Ihr Denken entwickelte sie in Auseinandersetzung mit zahlreichen Freunden, Gegnern und Geliebten.

Mut zur Mündigkeit
Faschismus, Konformismus, Gehorsam und Gewalt prägten Hannah Arendts Lebenszeit und bedrohten sie als Jüdin existenziell. Entstanden ist aus dieser Betroffenheit eine Philosophie, in deren Zentrum die Fähigkeit des Selberdenkens, des Handelns und des Neuanfangens steht – und die nichts an Aktualität verloren hat. Sieben Kerngedanken Arendts, die uns in die Zukunft führen.

Seyla Benhabib: „Von Arendt lässt sich lernen, wie man über Politik noch mit Hoffnung nachdenken kann“
In New York, wo Hannah Arendt nach ihrer Flucht bis zu ihrem Tod lehrte und lebte, treffen wir die Philosophin Seyla Benhabib. Sie ist mit Arendts Werk tief vertraut und erhält im Dezember den renommierten Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken. Wie hätte Arendt die Krisen unserer Zeit gedeutet? Wie hätte sie auf das Freund-Feind-Denken im Diskurs geschaut? Ein Gespräch über Hannah Arendt im Lichte der Gegenwart.

Arena
Redekunst mit weiblichem Vorzeichen
Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestags stand eine Rednerin mit ihrem Baby am Pult. Ein wirkmächtiges Zeichen – auch mit Blick auf die männlich konnotierte Rhetorik.

Dialexit
Der Brexit wollte die Einwanderungszahlen senken und Souveränität zurückgewinnen. Nun passiert das Gegenteil. Ein Lehrstück in Sachen Systemtheorie.

Marko Martin: „In Deutschland herrscht eine selbstgewählte Blindheit“
Der Schriftsteller und Essayist Marko Martin über sein neues Buch Freiheitsaufgaben, 35 Jahre deutsche Wiedervereinigung, ost- und westdeutsche Lebenslügen, die Verteidigung der Demokratie gegen innere und äußere Feinde, sowie Freiheit als „Ablehnung der Mutlosigkeit“.

Idealistische Keime des Digitalen
In Nepal und anderen Ländern revoltiert die Jugend und macht ihre vermeintliche Schwäche zur Stärke.

Einspruch: Keine mentale Aufrüstung im Namen Hegels!
In der letzten Ausgabe des Philosophie Magazins hatte Leander Scholz der militärischen Zeitenwende mit Hegels „Kampf um Anerkennung“ Legitimität zu verleihen versucht. Scholz deutet Hegel nicht nur falsch, sondern missbraucht ihn für politische Zwecke, meint Axel Honneth.

Manon Garcia: „Frauen sind weniger bereit, ihre Beziehung für die Freiheit zu riskieren“
Muss man die Hoffnung auf ein gelungenes Geschlechterverhältnis aufgeben? Der Vergewaltigungsfall der Französin Gisèle Pelicot erregte auch in Deutschland Aufsehen. Die Philosophin Manon Garcia wohnte dem Prozess bei. Welche Schlussfolgerungen zieht sie? Ein Gespräch über Männer und Frauen – und die Zukunft des Feminismus.

Sundays for Future
Mit Carlo Acutis und Charlie Kirk wurden zwei junge Männer auf ein Podest der Heiligkeit gehoben. Das sollte uns zu denken geben, meint Wolfram Eilenberger.

Leben
Zwischenmännlichkeit
Männer wünschen sich „Gute Nacht“ und filmen sich dabei. Der TikTok-Trend „Good Night, Bro“ illustriert den männlichen Kampf gegen patriarchale Dämonen.

Realitätsfilter
Ad-Blocker-Brillen versprechen Befreiung: Sie löschen Werbung in Echtzeit aus dem Sichtfeld, verdecken analog sowie digital Plakate, Bildschirme oder Logos und überblenden Werbeanzeigen durch einen roten Kasten.

princess treatment
In den sozialen Medien wird besonders umsichtiges Verhalten eines Partners als „princess treatment“ gelobt. Doch das ist nicht so schmeichelhaft, wie es scheint.

Woher kommt der Hass auf die Arbeitslosen?
Mit der „neuen Grundsicherung“ sollen Erwerbslose künftig stark unter Druck gesetzt werden. Auf welchem ideengeschichtlichen Grund ruht der Unmut gegen Menschen, die nicht arbeiten? Und wie erleben Arbeitslose selbst ihre Situation? Eine ideologiekritische Spurensuche.

Soll ich eine Freundschaft beenden, die mir nicht guttut?
Belastende oder gar „toxische“ Freundschaften zu beenden, gilt heute als Grundsatz der Psychohygiene. Was sagen Philosophen zu der Frage, wann wir mit Freunden Schluss machen sollten?

Wolfgang Engler: „Die DDR war eine Gesellschaft mit weit geöffneten Aufstiegskanälen“
Repressiv, aber durchlässig: So beschreibt der in Dresden geborene promovierte Philosoph Wolfgang Engler die ehemalige DDR. Ein Gespräch über Arbeiter als Gegenmacht und das eigene Leben zwischen Anpassung und Aufbruch.

Hedonistisch verzichten
Verzicht klingt lustlos, nach Diät, Gesundheitswahn, Askese. Doch auch für Hedonisten kann er interessant werden, nämlich an einem heiklen Punkt, den gerade sie erkennen sollten, meint unsere Kolumnistin Millay Hyatt.

Klassiker
Schleiermacher und die Religion
Was ist Religion? Ein Gebilde aus metaphysischen Glaubenssätzen über die Existenz und das Wirken Gottes? Für Friedrich Schleiermacher geht es im Glauben um etwas anderes: eine besondere Weise, die Wirklichkeit zu erfahren.
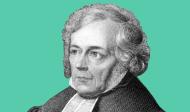
Was ist Kosmismus?
In unserer Rubrik Auf einen Blick machen wir Begriffsgeschichte in einem Schaubild verständlich. Diesmal: Kosmismus. Eine philosophische Strömung, die Ende des 19. Jahrhunderts im zaristischen Russland entsteht. Ihr Ziel war, das ewige Leben zu erreichen und den Weltraum zu erobern.

Paul Henri Thiry d’Holbach
„Die Natur“, schreibt der französische Radikalaufklärer und Atheist Paul Henri Thiry d’Holbach, habe „immer durch sich selbst existiert“. Wie ist das zu verstehen?

Salon
Geschlossene Gesellschaft
Thorsten Nagelschmidt & Lambert feiern das Grauen hinter dem Adventstürchen.

Am Ende des Urlaubs
Kingdom – Die Zeit, die zählt erzählt von der Annäherung einer Jugendlichen an ihren mafiösen Vater in einer Atmosphäre zerbrechlicher Normalität.

Auf der Suche nach dem richtigen Blick
Die Ausstellung Out of Focus zeigt Fotografien, die Leonore Mau in den 1960er-Jahren auf Haiti aufnahm, und setzt sich dabei kritisch mit dem westlichen Blick auf das vermeintlich „Andere“ auseinander.

Auf der Jagd nach Erkenntnis
Der Podcast Lange Nacht lässt die Neugier ungehindert schweifen.

Bücher
Den Menschen mit Würde bekleiden
Lea Ypi ist Kant-Forscherin und eine glänzende Chronistin ihrer albanischen Familiengeschichte. Jetzt stellt deren zweiter Teil eine hochphilosophische Frage ins Zentrum der Erzählung.

Die übersehene Minderheit
Unfertige Wesen, die zur Vernunft erzogen werden sollen, Verfügungsmasse der übermächtigen Erwachsenen, bedroht von Armut und Gewalt: Kinder stehen oft auf der Schattenseite der Gesellschaft. Drei neue Bücher zeigen, warum sich das dringend ändern muss, auch im Interesse unserer Demokratie.

Die Welt unterm Baum
Ein Weihnachtsfest ohne Sinn und Verstand? Und ohne Fantasie? Die Redaktion empfiehlt sechs Bücher, durch die sich das ändern lässt.

Finale
Phil.Kids (01/26)
Kleine Menschen wissen oft mehr als große. Wir fragen, Kinder antworten.
