Blick in den Rückspiegel
Der Selbstentwurf zielt auf zukünftige, noch nicht realisierte Möglichkeiten.
Jetzt, am Jahresbeginn, öffnet sich der Horizont aufs Neue: Was möchte ich 2022 anders machen? Welche Gewohnheiten sollte ich ab-, welche mir zulegen? Vielleicht wäre ein Berufswechsel sinnvoll? Oder muss ich mich einfach noch mehr anstrengen? Wer will ich sein?
In jungen Jahren kann gerade die letzte Frage nachgerade quälen. So groß ist der Entfaltungsspielraum, dass es schier unmöglich scheint, eine Entscheidung zu treffen: angefangen beim Wohnort bis hin zur Frage der Lebensform. Je älter ein Mensch ist, desto kleiner wird zwar (rein temporär bedingt) das existenzielle Experimentierfeld; die Qual der Wahl aber verringert sich dadurch nicht zwangsläufig – im Gegenteil. Denn je enger der Spielraum wird, desto stärker ist der Druck, endlich zu werden, der oder die ich sein will. Und, gegebenenfalls, die verbleibende Zeit noch zu nutzen für ganz neue Erfahrungen oder den ultimativen Karrieresprung. Vielleicht auch für eine neue Partnerschaft. Hauptsache, man trifft die richtige Entscheidung. Und bereut hinterher nichts! Womit der Kern des Problems sogleich benannt wäre: Denn woran orientiere ich mich eigentlich, wenn es um die Frage geht, wer ich sein will? Wo ist er, der Weg – mein Weg –, der mich durch das Dickicht der Optionen führt?
Nun, die Antwort, die sich aus der Philosophiegeschichte gewinnen lässt, lautet: Der Fehler liegt in Ihrer Perspektive. Genauer: in Ihrem Blick nach vorn. Solange Sie sich auf die Zukunft fixieren, werden Sie den Pfad nicht finden. Vielmehr müssen Sie sich ans Ende imaginieren. Sie müssen sich vorstellen, dass Sie zurückschauen auf Ihre Existenz, die sich nun nicht mehr ändern lässt.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Rahel Jaeggi: „Unser Verständnis von Selbstverwirklichung ist eine Zumutung“
Pathologien der Arbeit, gescheiterte Selbstentwürfe, entfremdetes Dasein: Rahel Jaeggis Philosophie zielt ins Herz der heutigen Leistungsgesellschaft. Mit ihrem kritischen Interesse an unseren Lebensformen will sie einen gesellschaftlichen Wandel einleiten
Die neue Ausgabe: Wer wäre ich, wenn …?
Viele Möglichkeiten, sich zu entwerfen, bleiben im Laufe eines Lebens unverwirklicht. Was aber geschieht mit all den nicht realisierten Versionen unseres Selbst? Und wie können wir mit ihnen umgehen? Ein Dossier über das Ich, andere Welten und Wege in eine Existenz ohne Reue.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
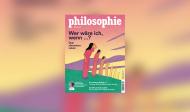
Überwindung als Versprechen
Die schillernde Vorsilbe „Trans-“ zielt mit einem Gelübde an die Überwindung des Alten ins Offene. Sie will in luftige Höhen gelangen und nicht zurückblicken. Dabei scheut sie sich, so Dieter Thomä, auch nicht vor Experimenten und Ekstase.

Wes Geistes Kind ist die Hamas?
Der Terror der Hamas folgt einem Plan, den Islamisten und Nazis vor Jahrzehnten entwickelt haben. Er zielt auf die Vernichtung aller Juden und die Beseitigung der westlichen Moderne. Notfalls auch um den Preis des eigenen Lebens.
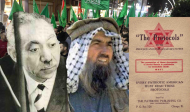
Probleme des Amerikanismus
Der Trumpismus zielt auf einen antiliberalen Regime Change – auch in Berlin. Die Amerikaliebe der Deutschen hilft ihm dabei.

Thomas Nagel: „Wir müssen auf zukünftigen moralischen Fortschritt hoffen“
Wie kaum einem anderen Denker ist es Thomas Nagel gelungen, die Spannbreite der Philosophie in den Blick zu nehmen. Seine Arbeiten reichen von Fragen des Bewusstseins über Ethik bis hin zu metaphilosophischen Überlegungen und bieten ein vielschichtiges Bild der Welt. Ein Gespräch mit Nagel über seinen berühmten Fledermaus-Aufsatz, moralischen Fortschritt und philosophische Fragen, die bleiben.

„Authentisch sein heißt, sein Potenzial verwirklichen“
Er ist der große Vordenker des Multikulturalismus. Aber auch in Fragen religiöser Toleranz oder kapitalistischer Entfremdung zielt Charles Taylors Denken ins Zentrum heutiger Debatten. Ein Gespräch über das Ich als Ware und kanadische Ureinwohner mitten in Berlin . Das Gespräch führte Wolfram Eilenberger.

Charles Taylor: "Authentisch sein heißt, sein Potenzial zu verwirklichen"
Er ist der große Vordenker des Multikulturalismus. Aber auch in Fragen religiöser Toleranz oder kapitalistischer Entfremdung zielt Charles Taylors Denken ins Zentrum heutiger Debatten. Ein Gespräch über das Ich als Ware und kanadische Ureinwohner mitten in Berlin