Catherine Newmark: „Die philosophische Essayistik hat aktuell Aufwind“
Seit 2009 wird auf dem Philosophicum Lech in Österreich der Tractatus-Preis für herausragende philosophische Essayistik verliehen. Heute Abend geht er an Isolde Charim. Wir sprachen mit Catherine Newmark, die Teil der Jury ist, über die diesjährige Preisträgerin und die Frage, was überhaupt ein philosophischer Essay ist.
Frau Newmark, Sie sind neben Daniela Strigl und Ijoma Mangold Teil der Jury des Tractatus-Preises, deren Entscheidung in diesem Jahr auf Isolde Charim und ihr Buch „Die Qualen des Narzissmus“ gefallen ist. Was hat gegenüber den anderen Nominierten den Ausschlag gegeben?
Als Jury hatten wir dieses Jahr wirklich die Qual der Wahl: wir haben viele sehr gute Texte gelesen und wir haben uns dann weniger gegen die anderen Nominierten als für Isolde Charim entschieden. Wir fanden, dass sie in Die Qualen des Narzissmus sehr viele sehr aktuelle gesellschaftliche Fragen in den Blick nimmt und auf philosophisch höchst anregende Weise untersucht.
In der Begründung wird hervorgehoben, dass es Charim gelingt, Sigmund Freuds Konzept des Narzissmus für unsere Zeit fruchtbar zu machen. Welche Erkenntnisse über unsere Gesellschaft tun sich auf, wenn man sie vor der Folie dieses Begriffs betrachtet?
Was Isolde Charim wirklich bemerkenswert gut gelingt, ist, unterschiedlichste Phänomene in der Gesellschaft durch die theoretische Brille des Narzissmus sehr plausibel zu erklären. Narzissmus ist bei ihr so etwas wie die Orientierung am Ich-Ideal: wir folgen heute weniger gesamtgesellschaftlich verbindlichen moralischen Gesetzen und Regeln, als dass wir uns jeder einzelner als kleine Ich-AG und kleiner Selbstverbesserer optimieren: für die Arbeitswelt genauso wie für unser Privatleben, für die Dating App genauso wie für das globale Social Media Publikum. Dabei kommt es auf „Performance“ mehr an als auf Inhalt oder Gehalt – und der Erfolg ist nicht mehr etwas tatsächlich vollbrachtes, sondern er hängt von der Gunst des Publikums ab. Denken Sie etwa an Beliebtheitsrankings in weiten Teilen der Internetkultur oder die Art und Weise, wie Kunden und Mitarbeiter in der Konsum- und Arbeitswelt bewertet und zum Feedback aufgefordert werden. Charim folgt diesem Schema durch ganz viele Bereiche unserer aktuellen Kultur und Politik und sie kann damit sehr vieles, was uns aktuell umtreibt, philosophisch gut erhellen.
Wie gelangen der Jury denn überhaupt die Bücher in die Hände, die für den Tractatus-Preis infrage kommen? Schlagen alle Mitglieder Werke vor?
Es gibt eine Ausschreibung, die Verlage sind aufgefordert, Texte einzusenden, wir können aber natürlich auch selber Bücher vorschlagen. Spannend ist, dass dabei auch immer wieder sich zeigt, dass die Wahrnehmung dessen, was ein philosophischer Essay ist, sehr unterschiedlich sein kann. Als Form ist der philosophische Essay nicht so ganz klar umrissen. Und dennoch hatte ich durch die Fülle der Einsendungen den Eindruck, dass die philosophische Essayistik aktuell Aufwind hat.
Woran machen Sie das fest?
Die Zahl philosophischer Texte mit einem Anspruch auf Lesbarkeit sowie mit einem klaren Blick für das aktuelle Zeitgeschehen war sehr hoch und in sich enorm vielfältig. Man kann also den Eindruck gewinnen, dass aktuell in der Publikationslandschaft die kürzere, publikumsfreundliche philosophische Form durchaus mehr gepflegt wird, als es vielleicht vor zehn Jahren der Fall war – es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von Verlagen, die explizit Essayreihen im Programm haben, auch philosophische.
Ist der Aufstieg des philosophischen Essays als Kommentar und Orientierungsversuch vielleicht auch als Zeichen einer Zeit zu lesen, die immer weniger Halt bietet?
Da kann man nur spekulieren, aber mir scheint, da ist was dran. Denn neben dem offensichtlich gesteigerten Verlags- und Publikumsinteresse an philosophischer Essayistik ist beim Lesen der Titel auch deutlich spürbar, wie akut den Autorinnen und Autoren ihre Themen unter den Fingern brennen. Und zwar unabhängig davon, ob es um Freiheit, um Klima oder um Krieg geht. Hier will sich der Welt mitgeteilt und philosophisch verstanden werden, was aktuell vor sich geht.
Wie kann man sich den Entscheidungsprozess der Jury vorstellen? Gibt es hitzige Diskussionen? Oder war in diesem Fall die Entscheidung doch schnell gefunden?
Es war in meiner Empfindung eine ausgesprochen angenehme und produktive Juryarbeit, weil wir uns in erster Linie wirklich mit Texten beschäftigt und ergebnisoffen miteinander diskutiert haben. Es ging nicht sofort darum, wer jetzt einen Preis bekommen soll, sondern in immer neuen Runden, in denen dann der Kreis der potenziellen Siegerinnen und Sieger immer kleiner wird, wirklich um die Diskussion von Gedanken und Texten.
Was unterscheidet für Sie denn ein gelungenes von einem großartigen philosophischen Werk?
Für diese Frage würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil ich einen Unterschied zwischen großartigen philosophischen Werken und einem tollen philosophischen Essay sehe, wie sie seit 2009 in Lech ausgezeichnet werden. Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft ist zweifellos ein großartiges philosophisches Werk, aber sicher kein Essay. Also es gibt wirklich wichtige, hoch komplizierte Texte, deren Durcharbeit sich lohnt. Aber es ist eben auch möglich, in einem lesbareren, alltagsnäheren Text interessante philosophische Gedanken zu entwickeln.
Wenn auch die Frage natürlich eine offene ist, können Sie vielleicht dennoch ein paar Merkmale nennen, die einen philosophischen Essay auszeichnen?
Hier kann ich nicht für die anderen Jurymitglieder sprechen, würde aber mindestens zwei Kriterien nennen. Erstens scheint mir ein sehr dezidierter und engagierter Gesellschaftsbezug unabdingbar zu sein. Es muss sich natürlich nicht um „Philosophie engagée“ handeln, aber ein Bezug auf Aktualität und gesellschaftliche Fragen, die tatsächlich als politisch und gesellschaftlich relevant gelten können, sollte gegeben sein. Und zweitens eben auch der Versuch, in der Form eine gewisse Stilistik und Lesbarkeit einzulösen. Wir reden also hier nicht von Texten mit Unterpunkt 3b, sondern von einem Text, der – und das passt auch zur diesjährigen Preisträgerin – immer wieder Aha-Momente hervorruft, die eine Art der Befriedigung, vielleicht auch der narzisstischen Befriedigung auslösen. •
Catherine Newmark ist Redakteurin und Moderatorin der Sendung „Sein und Streit“ beim Deutschlandfunk Kultur. Von 2015-2021 hat die an der FU promovierte Philosophin als Chefredakteurin der Sonderausgaben beim Philosophie Magazin gearbeitet. Seit 2023 gehört sie zur Jury des Tractatus-Preises des Philosophicums Lech.
Das Philosophie Magazin ist Medienpartner des Philosophicum Lech.
Weitere Artikel
Tractatus-Preis für Isolde Charim
Die Philosophin Isolde Charim erhält für ihr Buch Die Qualen des Narzissmus den Tractatus-Essaypreis 2023. Er wird vom Verein Philosophicum Lech vergeben, Medienpartner des Philosophie Magazins. Im Frühjahr haben wir mit Charim über freiwillige Unterwerfung, Selbstoptimierung als Schwindel und narzisstische Moral gesprochen. Wir gratulieren Isolde Charim herzlich zum Tractatus-Preis.

Catherine Newmark: „,Gefühle der Zukunft‘ ist eminent philosophisch, gedanklich interessant und zugleich praktisch hilfreich“
Preisträgerin des Tractatus 2025 ist die deutsche Philosophin Eva Weber-Guskar, die für ihren Essay „Gefühle der Zukunft“ gewürdigt wird. Ein Gespräch mit dem Jury-Mitglied Catherine Newmark über die Qualitäten dieses Buches und den Aufwind der philosophischen Essayistik.

Shortlist für den Tractatus-Essaypreis des Philosophicum Lech 2024
Der Verein Philosophicum Lech hat die Shortlist für den Tractatus – Preis für philosophische Essayistik bekanntgegeben. Wer die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält, wird am 20. September im Rahmen des 27. Philosophicum Lech verkündet. Das Philosophie Magazin ist Medienpartner.

Shortlist für den Tractatus-Essaypreis des Philosophicum Lech 2025
Der Verein Philosophicum Lech hat die Shortlist für den Tractatus – Preis für philosophische Essayistik bekanntgegeben. Wer die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält, wird Anfang September verkündet. Die feierliche Verleihung findet am 26. September im Rahmen des 28. Philosophicum Lech statt. Das Philosophie Magazin ist Medienpartner.

Ijoma Mangold: „Ein guter Essay ist Avantgarde“
Im Rahmen des Philosophicum Lech wird jährlich ein herausragender philosophischer Essay mit dem Tractatus-Preis ausgezeichnet. Der gestern bekanntgegebene Preisträger 2024 ist Philipp Hübl mit Moralspektakel. Was dieses Buch auszeichnet, erklärt das Jury-Mitglied Ijoma Mangold.
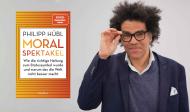
Christian Bermes: „Meinungen sind kein Ablassbrief, um sich in einem Paralleluniversum einzurichten“
Wir gratulieren Christian Bermes zur Platzierung seines Buches Meinungskrise und Meinungsbildung. Eine Philosophie der Doxa auf der Shortlist des Tractatus 2022. Bereits im Januar haben wir mit dem Philosophen darüber gesprochen, warum Meinungen keine Privatangelegenheit sind.

Ludwig Wittgensteins „Tractatus logico-philosophicus“
Die „Sprache verkleidet den Gedanken“, schreibt Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus logico-philosophicus. Doch welchen Gedanken verkleidete Wittgenstein selbst mit diesem Satz?

27. Philosophicum Lech: Sand im Getriebe
Sokrates hat die Philosophie einst mit einer lästigen Stechmücke verglichen: Ein Störmoment, das uns der Wahrheit ein Stück weit näherbringt. Kann die Philosophie diese Aufgabe heute noch erfüllen, oder mutiert sie zu einer Wohlfühlweisheit, die es allen recht machen will? Über diese und ähnliche Fragen werden beim 27. Philosophicum Lech Vortragende aus Philosophie, Sozial- und Kulturwissenschaften und benachbarten Disziplinen referieren und mit dem Publikum diskutieren.
