Henri Bergson und das Gedächtnis
Das Gedächtnis ist der Ort, an dem Erinnerungen gespeichert werden. Also muss es sich doch in irgendeinem Winkel unseres Gehirns befinden – so das verbreitete Vorurteil im Zeitalter bildgebender Verfahren. Mit Bergson hingegen, der heute vor 165 Jahren geboren wurde, lässt sich verstehen, dass das Gedächtnis mehr als ein Erinnerungsspeicher ist: Es ist mit der ganzen Persönlichkeit verbunden.
Das Wichtigste, was wir von Bergson über das Gedächtnis lernen können, lässt sich mit einem Satz zusammenfassen: Gedächtnis ist nicht nur die Erinnerung an etwas, sondern auch die Erinnerung von jemandem. In der Zeit um 1900 kristallisiert sich so eine Verbindung zwischen Bergson, Freud, aber auch Proust heraus. Für diese drei „Anwälte des Unvergesslichen“ (wie Ricœur sie nennt) ist „Gedächtnis“ nicht lediglich die Wiedergabe einer Sache oder einer Szene und auch keine Sammlung von Erinnerungen wie in einem Album: Das Gedächtnis hält die Geschichte zusammen oder sogar das Leben einer Person. Aber diese drei Autoren sind der Ansicht, dass diese totale Erinnerung, die in uns ist, die wir sind, ständig ins Unbewusste verdrängt wird. Und so sinkt unsere Erinnerung – jene Erinnerung, die uns gehört und uns ausmacht – ins Vergessen.
Man könnte glauben, dass eine solche Verknüpfung zwischen Gedächtnis und subjektivem Bewusstsein im Zeitalter der Kognitionswissenschaften und des Computers überholt sei. Und Bergson ist in der Tat von den genannten drei Autoren derjenige, der am stärksten Gefahr läuft, als unzeitgemäß zu gelten. Denn seine Theorie des Gedächtnisses steht im Gegensatz zur Theorie der verschiedenen Hirnregionen, weil er metaphysische Konsequenzen zieht, mit denen er letztlich das Gehirn vom Geist unterscheidet. Man kann also nicht alles vorbehaltlos übernehmen. Doch einen Punkt muss man in jedem Falle aufgreifen: Das Gedächtnis ist nicht nur die Erinnerung an etwas, sondern immer auch die Erinnerung von jemandem. Wenn zum Beispiel eine Person an einer „neurodegenerativen“ Krankheit leidet, verliert sie nicht nur die eine oder andere Erinnerung. Wer „das Gedächtnis“ verliert, wie es so schön heißt, verliert auch eine Beziehung zu sich und den anderen.
Wir müssen also Bergsons Theorie wiederaufgreifen, denn sie gibt uns (psychologische) Kriterien und (metaphysische) Aspekte an die Hand, um zwischen zwei Arten des Gedächtnisses zu unterscheiden, dem „Gewohnheitsgedächtnis“ und dem „reinen Gedächtnis“. Aber wir müssen sie auch kritisieren oder modifizieren, um zeitgenössischen Erfahrungen und aktuellen Theorien Rechnung zu tragen.
Die Tiefe des Gedächtnisses
Dass Materie und Gedächtnis bei seiner Veröffentlichung 1896 schlagartig berühmt wurde und sehr schnell zum Klassiker wurde, verdankt sich nicht in erster Linie den metaphysischen Theorien, die das Buch entwickelt. Es war die psychologische Unterscheidung zwischen den „beiden Gedächtnissen“, die es bekannt machte – der reinen Erinnerung, die die einzigartigen Ereignisse meiner individuellen Geschichte enthält, und dem Gewohnheitsgedächtnis, das nach dem Vorbild des mechanischen Auswendiglernens eines Gedichts funktioniert. Um den Unterschied zwischen diesen beiden Gedächtnisformen richtig zu verstehen, muss allerdings herausgestellt werden, dass sie auf verschiedene grundlegende Charakteristika des Gedächtnisses Bezug nehmen.
Das erste Charakteristikum des Gedächtnisses ist, dass es die Vergangenheit wiedergibt. Nun gibt es dabei zwei verschiedene Arten: „Ein Wort einer fremden Sprache, das mein Ohr trifft, kann mich an diese Sprache im allgemeinen denken machen oder aber an eine Stimme, welche sie einstmals auf eine gewisse Art aussprach.“ Das ist eines der Beispiele, die Bergson anführt, um zwischen den zwei Gedächtnissen zu unterscheiden. Denn wenn das Gedächtnis nur eine Gesamtheit aus Erinnerungen oder Bildern wäre, würde man eine Wahrnehmung immer mit demselben Bild assoziieren. Ich höre ein Wort, ich erinnere mich an seine Bedeutung; ich beginne, ein Gedicht aufzusagen, und rezitiere es bis zum Schluss; feste Assoziationen, Gewohnheitsgedächtnis.
Doch „ein Wort“ kann verschieden tiefe Resonanzen in mir hervorrufen, kann immer weiterhallen, kann die ganze Vergangenheit meines Lebens heraufbeschwören (wie Prousts Madeleine, also etwas völlig anderes, oder ein Traum, der bei einer Analysesitzung zu meiner gesamten Vergangenheit in Bezug gesetzt wird). Hierin besteht Bergson zufolge die wesentliche Unterscheidung zwischen den beiden Gedächtnisformen. Er zeigt, dass man die Vergangenheit auf anonyme, mechanische, immer gleiche Weise wiedergeben kann, wie etwas Unveränderliches (das Gedicht ist für alle gleich). Oder man kann im Gegenteil dazu die Vergangenheit auf eine sich ständig verändernde, einzigartige Weise wiedergeben, wie ein Ereignis in seinem Leben (der Tag, an dem ich dieses Gedicht lernte, wer mir dieses Gedicht beigebracht hat usw.). Das Gedächtnis ist also nicht nur ein objektiver, motorischer Mechanismus, sondern es hat auch eine subjektive, individuelle Tiefe. Doch warum zieht Bergson aus dieser Analyse metaphysische Konsequenzen und welche sind dies?
Vom Wo zum Wie der Erinnerung
Die bekannteste metaphysische Schlussfolgerung, und zugleich die umstrittenste, betrifft das Verhältnis zum „Gehirn“. Man kann leicht verstehen, warum Bergson aus der Unterscheidung der beiden Gedächtnisformen die Schlussfolgerung zieht, dass das reine Gedächtnis nicht im Gehirn „lokalisiert“ sei. Denn für ihn wie viele seiner Zeitgenossen besteht das Hirn lediglich in der Verkettung bestimmter Bewegungen und somit in „lokalen“ Strukturen (den berühmten Hirn„regionen“, die damals von den Neurologen entdeckt wurden): Ein „globales“ Gedächtnis, das veränderlich ist und meine gesamte Vergangenheit wachrufen kann, fände demzufolge im Gehirn keinen Platz. Bergson hat stets für sich beansprucht, mit der psychologischen Unterscheidung zwischen den zwei Formen des Gedächtnisses ein genaues Kriterium für einen metaphysischen Dualismus zwischen Gehirn und Geist gefunden zu haben – ein Dualismus, den die heutigen Neurowissenschaften ablehnen.
Doch trotz der aktuellen Hypothese von der Einheit von Gehirn und Geist bleibt die Unterscheidung zwischen den beiden Gedächtnisformen relevant. Statt einfach nur Gehirn und Geist einander gegenüberzustellen (als wäre Letzterer von Ersterem unabhängig), könnte diese Unterscheidung uns vielmehr auf zwei verschiedene Aspekte unseres Hirn-Geistes aufmerksam machen: dass dieser einerseits in der Lage ist, angemessen auf Situationen zu reagieren, indem er dafür nützliche Erinnerungen aktiviert, dass er andererseits aber auch jeden Sinneseindruck unseres Lebens in einem Gedächtnis festhalten kann, das „koextensiv mit dem Bewusstsein“ ist, wie Bergson schreibt.
Doch wenn das reine Gedächtnis nicht im Gehirn verortet werden kann, „wo“ werden die Erinnerungen dann bewahrt? Dies ist die zweite wesentliche Charakteristik des Gedächtnisses bei Bergson: die Bewahrung der Vergangenheit. Wir neigen dazu, sofort zu fragen, „wo“ die Vergangenheit gespeichert wird, weil wir die Angewohnheit haben, räumlich und nicht zeitlich zu denken, so Bergson. Doch man müsse sich vielmehr fragen, „wie“ die Vergangenheit erhalten bleibt. Ihm zufolge werden die Erinnerungen durch jenen Akt des Geistes bewahrt, der mit dem Verstreichen der Zeit zusammenhängt, wo jeder „Augenblick“ bereits eine Gedächtnisschicht bildet, zum Beispiel weil ich mir die Worte eines Satzes merke. Die Erinnerungen bleiben durch den reinen „Akt“ der Verdichtung der Vergangenheit in der Gegenwart erhalten. Unser Leben lässt sich dabei mit einem langen Satz oder einer langen Melodie vergleichen. Es ist also die „Dauer“, die die Erinnerung bewahrt.
Anwälte des Unvergesslichen
Doch der Philosoph geht noch weiter: Unsere Fokussierung auf die unmittelbare Handlung, durch die wir zum räumlichen Denken neigen, verhüllt nicht nur unser Gedächtnis als subjektives Ganzes, sie verstellt uns auch die Erinnerung an die materiellen Dinge, welche ebenfalls in der reinen Erinnerung überdauern. So ist die Materie also nicht das Gegenteil des Gedächtnisses (falsche Interpretation des Buchtitels!): Die Materie ist eine niedere, aber reale Stufe des Gedächtnisses.
Die praktischen Konsequenzen aus der Unterscheidung zwischen den beiden Gedächtnisformen sind immens. Wir werden hier nur die drei wichtigsten erwähnen. Der erste Punkt betrifft die Subjektivität des Gedächtnisses, die durch Globalität und Individualität der Erinnerungen definiert ist: Das Gedächtnis „von jemandem“ ist nicht die Summe all seiner Erinnerungen, sondern besitzt Tiefe, Einzigartigkeit, einen gewissen Ton und Stil. Die zeitliche und individuelle Singularität des gesamten Gedächtnisses kann vollständig in Gehirn und Leib eingeschrieben sein. Doch vor allem kann die Subjektivität der Erinnerung nicht von der Frage nach deren Vergessen oder Verdrängung getrennt werden. Hier steht Bergson zweifellos Freud und Proust nahe.
Sie alle beschäftigen sich mit den Hindernissen, die eine tiefere Erinnerung zu überwinden hat, und deren Wiederkehr ins praktische Leben. Beispielsweise kann ein Kranker, der fast alles vergessen hat, plötzlich eine Melodie summen, die ihn wieder zu sich zu bringen scheint: Das reine Gedächtnis ist also noch lebendig, während das Gewohnheitsgedächtnis beinahe verschwunden ist. Aber ist diese reine Erinnerung tatsächlich unabhängig vom Gehirn? Bergson und Freud mögen zwar die „Anwälte des Unvergesslichen“ sein, doch dieser Punkt ist völlig ungewiss. Was, wenn es nichts mehr gibt, was dieses Tiefengedächtnis weckt? Dies hängt – zwar anders als die lokal verorteten Erinnerungen, aber dennoch – vom Gehirn ab. Es ist also unser Gehirn, das zwei Seiten hat, eine lokale und eine globale, es ist sequenziell und individuell.
Wertvolle Zeugenschaft
In einem anderen Punkt ist Bergsons Unterscheidung zwischen den beiden Formen des Gedächtnisses allerdings fruchtbar: Denn das Gedächtnis ist nicht originär subjektiv. Unsere Erinnerungen sind vielmehr nur persönlich, weil sie interpersonell sind: Wir erinnern uns an etwas, weil wir uns an jemanden erinnern, weil wir uns gegenseitig aneinander erinnern. Bergson geht darauf in seinem Buch Die beiden Quellen der Moral und der Religion (1932) ein, an einer Stelle, wo es um zwei verschiedene Erziehungsmethoden geht. Die eine besteht im Eintrichtern durch Wiederholung – es handelt es sich um das Gewohnheitsgedächtnis. Die andere jedoch ist nicht ein einsames, reines Gedächtnis. Es ist die Imitation oder Inspiration durch jemanden. Hier haben wir eine andere Quelle des Gedächtnisses, auf die heute beim Umgang mit Störungen von Gedächtnis und Gehirn zurückgegriffen werden kann. Denn auch wenn mein Gegenüber sein Gedächtnis verloren hat – wenn dieser Mensch für sich selbst nicht mehr er selbst ist –, so bleibt er es doch noch für mich, in mir.
Schließlich muss noch ein drittes grundlegendes Merkmal des Gedächtnisses erwähnt werden: Durch das Erinnern wird die Vergangenheit wieder hervorgerufen; sie bleibt erhalten, aber sie wird auch erneut empfunden. Darum betont Bergson den Unterschied zwischen Gedächtnis und Vorstellung – zwischen dem, woran ich mich erinnere, und dem, was ich mir vorstelle. Die Erinnerung verkörpert sich in Bildern, aber ein Bild erscheint mir nur dann als Erinnerung, wenn es in der Vergangenheit tatsächlich erlebt und empfunden wurde. Das bedeutet, dass das Gedächtnis auch der Beweis für die Realität der Vergangenheit ist. Wie es Ricœur unter Berufung auf Bergson in Gedächtnis, Geschichte, Vergessen (2004) gezeigt hat, ist dies nicht nur die Bedingung für das Leben jedes Einzelnen, sondern auch für die allgemeine Geschichte. Die Erinnerung bezeugt die Realität der Vergangenheit und steht nicht nur gegen die Gefahr des Vergessens, sondern auch gegen die Leugnung (oder das Totschweigen) der Erinnerung.
So viel zur Tragweite einer Philosophie, die heute danach verlangt, weitergedacht zu werden. Um 1900 gab es von Freud über Proust bis Bergson verschiedene Arten zu zeigen, dass die Vergangenheit sich von der Gegenwart unterscheidet, dass sie von ihr verdrängt wird, aber nicht weniger wichtig ist als sie. Alle drei betonten die Bedeutung der Vergangenheit nicht nur, um die Erinnerung an etwas zu retten, sondern auch die Erinnerung von jemandem wachzurufen. •
Frédéric Worms unterrichtet an der Universität Lille-3 und leitet das internationale Studienzentrum für zeitgenössische französische Philosophie (CIEPFC) an der École normale supérieure. Zum Thema erschien von ihm auf Deutsch „Bergson und die deutsche Philosophie 1907-1932“ (Karl Alber, 2018).
Weitere Artikel
Henri Bergson und die Zeit
Wie erfahren wir ursprünglich die Zeit? Niemals als „homogenes Medium“, indem „die Termini einer Sukzession sich im Verhältnis zueinander exteriorisieren“, meint Henri Bergson. Hier eine Verständnishilfe.

Paul Henri Thiry d’Holbach
„Die Natur“, schreibt der französische Radikalaufklärer und Atheist Paul Henri Thiry d’Holbach, habe „immer durch sich selbst existiert“. Wie ist das zu verstehen?

Wie schaffen wir das?
Eine Million Flüchtlinge warten derzeit in erzwungener Passivität auf ihre Verfahren, auf ein Weiter, auf eine Zukunft. Die Tristheit und Unübersichtlichkeit dieser Situation lässt uns in defensiver Manier von einer „Flüchtlingskrise“ sprechen. Der Begriff der Krise, aus dem Griechischen stammend, bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Lage mit offenem Ausgang – und so steckt in ihm auch die Möglichkeit zur positiven Wendung. Sind die größtenteils jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen, nicht in der Tat auch ein Glücksfall für unsere hilf los überalterte Gesellschaft? Anstatt weiter angstvoll zu fragen, ob wir es schaffen, könnte es in einer zukunftszugewandten Debatte vielmehr darum gehen, wie wir es schaffen. Was ist der Schlüssel für gelungene Integration: die Sprache, die Arbeit, ein neues Zuhause? Wie können wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, einbinden in die Gestaltung unseres Zusammenlebens? In welcher Weise werden wir uns gegenseitig ändern, formen, inspirieren? Was müssen wir, was die Aufgenommenen leisten? Wie lässt sich Neid auf jene verhindern, die unsere Hilfe derzeit noch brauchen? Und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Mit Impulsen von Rupert Neudeck, Rainer Forst, Souleymane Bachir Diagne, Susan Neiman, Robert Pfaller, Lamya Kaddor, Harald Welzer, Claus Leggewie und Fritz Breithaupt.
Bentham und die Transparenz
Im Gefängnis, das Jeremy Bentham 1791 als „Panoptikum“ entwarf, sollte das Licht der Aufklärung noch den hintersten Winkel erhellen. Doch geriet dieses bei der Nachwelt in Verruf und der Philosoph avancierte zum zynischen Architekten eines gesellschaftlichen Transparenzwahnsinns. Heute vor 276 Jahren wurde er geboren.

5 Irrtümer über unser Gehirn aufgeklärt
Wir haben kein „Reptiliengehirn”, viele Persönlichkeitstests sind unzuverlässig und Emotionen werden nicht von Hormonen „gesteuert”. Der Neurowissenschaftler Albert Moukheiber widerlegt diese und zwei weiteren Mythen über unser Gehirn.

Mazviita Chirimuuta: „Neurowissenschaftliche Modelle müssen mit mehr Vorsicht interpretiert werden“
Was, wenn unsere neurowissenschaftlichen Modelle des Gehirns zu vereinfachend sind, um die Realität abzubilden? Zu dieser Lektion der Demut lädt das Buch The Brain Abstracted ein, das in Großbritannien den Preis des Royal Institute of Philosophy gewann. Ein Interview mit dessen Autorin Mazviita Chirimuuta.
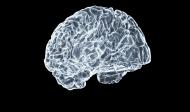
Richard David Precht: „Sind alle Fragen beantwortet, ist die Philosophie am Ende“
Von Henri Bergson bis Ludwig Wittgenstein: Im aktuellen Band seiner Philosophiegeschichte führt Richard David Precht durch das intellektuelle Trümmerfeld des frühen 20. Jahrhunderts. Im Interview spricht er über die Unmittelbarkeit des Lebens, philosophische Selbstvermarktung und die Faszination des Banalen.

Jan Assmann: „Es gibt keine wahre Religion“
Ägypten ist die eigentliche Wiege der europäischen Kultur, monotheistische Religionen neigen zur Gewalt, der Holocaust wird die Religion der Zukunft. Der Ägyptologe Jan Assmann gehörte zu den thesenstärksten Kulturtheoretikern unserer Zeit. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. 2013 führten wir ein Gespräch mit dem Mann, dessen Gedächtnis mehr als 6000 Jahre in die Vergangenheit reicht.
