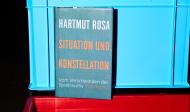Modern begraben?
Friedhof war gestern, es lebe das Waldbegräbnis! Der Mensch von heute sehnt sich im Tod nach Naturnähe. Ein Missverständnis? Die Kolumne von Hartmut Rosa
„Was kommt nach dem Tod? Wir können es Ihnen sagen!“ So lockt der ebenso originelle wie makabre Werbespruch eines österreichischen Bestattungsunternehmens. Weil niemand weiß, was kommt, verrät der Umgang mit unseren „sterblichen Überresten“ zwar rein gar nichts über ein Leben nach dem Tod, dafür aber sehr viel über unsere diesseitige Existenz, genauer: über unser Verhältnis zur Welt und zum Leben. Und dieses Verhältnis, so offenbart ein Blick auf aktuelle Bestattungstrends, scheint nachgerade paradox. Die größte Veränderung besteht dabei in einer unauf haltsam scheinenden Zunahme von Feuer-, See- und Waldbestattungen. Immer mehr Menschen wünschen, dass ihre Asche unter den Bäumen, im Meer, am Berg oder auch auf einer Wiese verstreut werde: Möglichst naturnah eben, so die gängige Begründung. Möglichst im Einklang mit den großen Kreisläufen allen Seins. Wie künstlich-kitschig, arbeitsintensiv, kulturalisiert und ritualisiert wirkt dagegen die Friedhofsbestattung. Es lohnt sich, diese Begründung genauer zu untersuchen: möglichst naturnah?
Dieser Gedanke beruht auf einer grandiosen Selbsttäuschung. Denn wer sich für die Urnenbestattung in „freier Wildbahn“ entscheidet, dem ist die Aussicht, seinen Körper nach dem Ableben tatsächlich den Naturprozessen zu überlassen, offenbar ein Gräuel. Die langsame, aber vollkommen natürliche Zersetzung durch Bakterien, Maden und Würmer, die bei einem ins Erdreich eingelassenen Sarg abzusehen ist – sie erweckt bei mehr und mehr Menschen tiefe Abscheu. Klassische Friedhofsbeerdigungen kommen aus der Mode, denn Sterbliche möchten heute möglichst rein und radikal verbrannt werden. Nichts soll in nichtpurifizierter Form an die Natur zurückgegeben werden. Eher lassen wir uns zu stahlharten Diamanten pressen.
Als Spätmodernen ist uns der Gedanke zuwider, dass der Naturkreislauf des Werdens und Vergehens, der fortwährenden Metamorphose von lebendem Organischem in totes Organisches und umgekehrt, durch unseren Körper hindurchgehen könnte, dass wir zu Humus für neues Leben werden – so wie es die Bibel noch kennt: Aus Staub bist du und zu Staub wirst du. Wir wollen der Natur nahe sein, ja. Aber wir wollen sie nicht sein und nicht werden. Noch nicht einmal im Tod.
Das Zeitalter der Moderne, so analysiert der kanadische Sozialphilosoph Charles Taylor, basiert wesentlich auf einer spirituellen Unabhängigkeitserklärung von der Natur. Diese wiederholen wir in ritualisierter Form sogar noch im Tode: Der Rauch soll aufsteigen in den Himmel, mit oder ohne Seele, und uns damit dem Naturkreislauf entziehen, endgültig und radikal. Als moderne Menschen brauchen wird die Natur als das Andere, bei dem wir wohnen können, als Lebende oder als Asche, aber eben nur in der Abgrenzung von ihr – nicht als ihr organischer Bestandteil.
Doch wie der französische Denker Bruno Latour festhält, bleibt dieser Versuch, zwischen Kultur und Natur eine kategoriale Grenze einzuziehen, letztlich zum Scheitern verurteilt. „Wir sind nie modern gewesen“ lautet daher einer von Latours bekanntesten Buchtiteln. Immer wieder nämlich fusionieren Kultur und Natur hinter unserem Rücken, holt uns die Natur ein, amalgamiert sie sich mit dem künstlich Hergestellten. Und, tatsächlich, bei näherem Hinsehen zeigt sich: Sogar im Tode noch bleiben wir unmodern. Denn auch unsere Asche wird für die Natur noch zum Dünger und zum Nährstoff. Ob daraus auch folgt, dass wir nie so endgültig sterben? Es wäre einen Gedanken wert. •
Weitere Artikel
Modern begraben?
Friedhof war gestern, es lebe das Waldbegräbnis! Der Mensch von heute sehnt sich im Tod nach Naturnähe. Ein Missverständnis?
Hartmut Rosa: „Ich will den Modus unseres In-der-Welt-Seins ändern”
Hartmut Rosa ist ein Meister in der Analyse moderner Entfremdungsdynamiken. Der Jenaer Soziologe bringt kollektive Gefühle und Sehnsüchte so präzise wie eigenwillig auf den Begriff. Ein Gespräch mit einem Denker, für den sein Schreiben immer auch Selbstergründung ist.

Hartmut Rosa: „Die Weltbeziehung zu ändern, ist die tiefste Revolution überhaupt“
Wir denken uns gern als Akteure, existenziell wie politisch. Wahre Transformation aber geschieht nicht im Modus der Verfügbarkeit, erläutert Hartmut Rosa im Interview. Außerdem spricht er über sein Werden als Wissenschaftler, das Verhältnis von Leben und Denken und die Lehren aus der Coronakrise.

Warum singen wir?
Ob unter dem Tannenbaum, in der Karaoke-Bar oder im Chor: Zu singen ist offenbar ein tiefes menschliches Bedürfnis. Aber warum genau? Platon, Nietzsche und Hartmut Rosa liefern drei philosophische Positionen.

Die Kraft des Glücks
Wer nach Glück strebt, so der Vorwurf, ist am Leiden der anderen nicht interessiert, verursacht es durch Konsum und Ressourcenverbrauch gar selbst. Hartmut Rosa und Robert Pfaller setzen sich auf je eigene Weise mit den Voraussetzungen eines gelungenen Lebens auseinander.

Zwischenruf zur Frage der Gewalt
Angesichts des Krieges im Sudan fordert der Westen die Parteien zu Gewaltverzicht und Verhandlungen auf. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg indes werden Friedensbemühungen als Bündnis mit dem Bösen angeprangert. Ist das konsistent? Ein Impuls von Hartmut Rosa.

Wie viel Zukunft verträgt die Gegenwart?
Das schnelle Leben schürt unsere Sehnsucht nach voller Gegenwärtigkeit. Wie ist dieses Verlangen zu bewerten? Ist die Konjunktur des Achtsamkeitskultes Ausdruck eines tiefen Resonanzbedürfnisses – oder einer kindlichen Regression? Ein Streitgespräch zwischen Hartmut Rosa und Armen Avanessian.
Vergiss die Smartwatch
Regelwerke und Zahlen statt Erfahrung und Fingerspitzengefühl? Der Soziologe Hartmut Rosa warnt in Situation und Konstellation vor einer bürokratisierten Lebenswelt – und plädiert dafür, Spielräume zurückzugewinnen.