Staatsaffäre in Anführungszeichen
Mit einem Schmähgedicht lotete Jan Böhmermann die Grenzen der Äußerungsfreiheit aus. Warum Gottlob Frege den Satiriker höchstwahrscheinlich freisprechen würde.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Gottlob Frege und die Sprache
Gottlob Frege, dessen Todestag sich am 28. Juli 2025 zum 100. Mal jährte, gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie: jener Strömung, die sich von metaphysischer Spekulation abwandte und nach einer präzisen, an die Mathematik erinnernden Sprache suchte. Was hat uns Frege über Funktionsweise und Fallstricke der Sprache zu sagen?
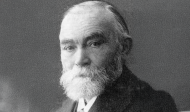
Hätte Gottlob Frege gegendert?
Die analytische Philosophie nimmt es mit der Sprache sehr genau. Täten wir also nicht gut daran, sie in der Debatte um inklusive Sprache zu befragen?

Jan Assmann: „Das Verhüllen des Kopfs hat mit Religion nichts zu tun“
Der EuGH formulierte jüngst Hürden für ein Verbot von Kopftüchern am Arbeitsplatz. Religionswissenschaftler Jan Assmann erklärt, warum solch ein Verbot besser komplett unrechtmäßig sein sollte – und warum die Verhüllung eigentlich nichts mit Religion zu tun hat.

Jan-Werner Müller: „Mit Trump könnte ein Autokrat in spe gewinnen“
Trump steuert mit großen Schritten auf den Sieg zu. Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller warnt vor einem Mann, der die Republikanische Partei in eine Art Familienunternehmen verwandelt und das Justizsystem zu seinen Gunsten umgebaut hat.

Jan-Werner Müller: „Der Kulturkampf der Republikaner ist ein Ablenkungsmanöver“
Präsident Trump erkennt seine Wahlniederlage noch immer nicht an und verschärft so die Spaltung des Landes. Was hinter der polarisierenden Politik der Republikaner steht und warum die Demokraten eine wichtige Chance vergeben haben, um diese zu stoppen, erläutert der in Princeton lehrende Populismusforscher Jan-Werner Müller im Gespräch.

Jan-Werner Müller: „Auch Autokraten sind lernfähig“
Die Demokratie gerät durch autoritäre Kräfte immer weiter unter Druck. Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller erklärt, warum über Autokraten oft falsche Annahmen herrschen, welche entscheidende Frage man an politische Eliten richten sollte und weshalb sich hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Jan Assmann: „Es gibt keine wahre Religion“
Ägypten ist die eigentliche Wiege der europäischen Kultur, monotheistische Religionen neigen zur Gewalt, der Holocaust wird die Religion der Zukunft. Der Ägyptologe Jan Assmann gehörte zu den thesenstärksten Kulturtheoretikern unserer Zeit. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. 2013 führten wir ein Gespräch mit dem Mann, dessen Gedächtnis mehr als 6000 Jahre in die Vergangenheit reicht.

Jan Slaby: „In-der-Welt-Sein ist deutlich mehr als Curlingsteine durch die Gegend schieben“
Die Liste der Dinge, die Künstliche Intelligenzen besser können als Menschen, wächst stetig. Nach Erfolgen in den Denksportarten wie Go und Schach hat ein Roboter nun erstmals Profispieler im Curling geschlagen. Manche Experten sehen darin einen Durchbruch für autonome KIs. Der Philosoph Jan Slaby ist hingegen skeptisch. Die Potentiale der Zukunft lägen vielmehr in hybriden Systemen.
