Tod aus Verzweiflung
Alkohol, Drogen, Selbstmord: In den USA schießt die Zahl der Todesfälle in die Höhe, während die Wirtschaft immer weiter wächst. Unser Reporter versucht, dieses Paradox mit der Soziologie von Émile Durkheim zu ergründen.
Als Halbwüchsiger fand Jesse oft Zuflucht bei einem Freund aus Kindertagen. Man traf sich auf dem abgelegenen Gelände seines Elternhauses. Hier konnte man Bier trinken, angeln und von der Ladefläche eines Pick-up schießen. Also ausspannen und völlig ungezwungen sein, wie man es in Louisiana so macht. Inzwischen ist Jesse 30 Jahre alt, und auch heute sitzt er vor dem Haus seines alten Freundes an einem kleinen Teich, starrt auf die Angel im Wasser – und erzählt von seinem Vater. „Er stammte aus einer wohlhabenden Familie. Er bekam alles, was er wollte, auf einem silbernen Tablett serviert und er war sehr intelligent – er ist zur Uni gegangen, weil er Lust hatte, etwas zu lernen.“
Dennoch verfällt Jesses Vater den Drogen, kaum dass er erwachsen ist. Irgendwann entdeckt er Oxycontin, ein Schmerzmittel, „für ihn das ultimative Ding“. Der Trip endet am 4. Juli 2016, dem amerikanischen Nationalfeiertag, durch einen Gewehrschuss mitten ins Herz. „Sein Kampf ist zu Ende“, sagt Jesse leise, seine Stimme zittert kaum hörbar. Der Selbstmord seines Vaters war nicht der einzige Tod, den er verkraften musste: Der Vater seiner Halbschwester erhängte sich 2015 nach Jahren der Abhängigkeit von Alkohol und Betäubungsmitteln: „Ich habe es nie verstanden“, meint Jesse zu mir. „Manche sagen, es sei eine Krankheit, aber bei manchen Menschen kann man es einfach nicht wissen.“ Er erzählt mir auch, dass sich sein Freund aus Kindertagen irgendwo in dem Holzhaus hinter uns zurückgezogen habe, um Zuflucht in Schmerzmitteln zu suchen. Er wird den ganzen Abend nicht herauskommen.
Die Stadt Lafayette, aus der Jesse stammt, liegt in Louisiana, doch die Geschichte, die er uns berichtet, spielt sich jeden Tag überall in den Vereinigten Staaten ab: Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Zahl der Todesfälle durch Selbstmord, Alkohol- und Drogenmissbrauch in den USA in die Höhe geschnellt und trägt so zu einem allgemeinen Absinken der Lebenserwartung bei. Ein Phänomen, das umso merkwürdiger ist, als es vor allem weiße Männer mittleren Alters betrifft – historisch nicht unbedingt die am stärksten benachteiligte Bevölkerungsgruppe – und das zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft seit zehn Jahren ununterbrochen wächst. Der Durchschnittsamerikaner scheint heute „an Verzweiflung“ zu sterben, meinen die Wirtschaftswissenschaftler Sir Angus Deaton und Anne Case, die den Ausdruck death of despair prägten. Sie waren die Ersten, die Alarm schlugen – aber woher genau kommt die Verzweiflung? Es ist ein verblüffendes Paradox: Die Amerikaner profitieren einerseits von einer Wirtschaft mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von fast 60 000 Dollar pro Kopf und einer Arbeitslosenquote, die gegen null tendiert. Doch gleichzeitig bringen sich immer mehr von ihnen um. Wie also ist dieses merkwürdige Unbehagen im reichsten Land der Welt zu erklären?
„Big Pharma“ und die Konjunktur der Opiate
Die Gebirgskette der Appalachen war im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner einmal das Rückgrat der Nation: In den Tälern am Fuße dieser dunstverhangenen Bergkämme schufen die ersten Siedler eine Kultur, die auf Country-Musik, Schnaps und harter Arbeit beruhte. Die Kohlebergleute des 20. Jahrhunderts waren ihre stolzen Erben. Doch die Automatisierung des Bergbaus und die darauffolgende Armut ließen dieses Bild weitgehend verblassen. Schlimmer noch: Diese Region ist heute das Epizentrum einer der heftigsten Drogenepidemien, die das Land erlebt hat. 2017 starben 70 000 Amerikaner an einer Überdosis – also mehr als im Irakkrieg, Afghanistankrieg und Vietnamkrieg zusammengenommen –, darunter 48 000 an Opiaten. „Schuld ist die Pharmaindustrie. Ende der 1990er-Jahre lancierte sie eine massive Kampagne, um die Leute zu überzeugen, dass Opiate nicht schädlich seien.
So haben sie erreicht, dass Ärzte bei allen möglichen gewöhnlichen Schmerzen Opiate verschreiben.“ In einem Restaurant in Roanoke in Virginia liefert mir Beth Macy eine ausgefeilte Argumentation. Durch ihre Medienauftritte ist die erfahrene Journalistin für die Einwohner der kleinen Bergarbeiterstädte zu einer Lokalmatadorin geworden. Ihren Worten zufolge ist sie selbst Zielscheibe von großen Unternehmensgruppen wie Purdue Pharma, dem Hersteller von Oxycontin, geworden. „Die Opiate wurden Teil amerikanischer Hausapotheken“, fährt sie fort, „und so kamen auch Jugendliche damit in Kontakt.“ Um den Hals trägt sie ein Medaillon mit einem Erinnerungsfoto von Tess, einer jungen Frau, die bereits in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse verkraften musste und der man zwei lange Therapien mit Opiaten wegen einer einfachen Bronchitis verschrieben hatte. Von dieser Behandlung führte der klassische traurige Weg über Betäubungsmittel vom Schwarzmarkt, Heroin in Pulverform (zuletzt intravenös) bis hin zur Überdosis.
Die Straße nach West Virginia verläuft über waldige Berge auf und ab. Man hat die nostalgische Stimme John Denvers im Ohr, der die „Country Roads“ der „Mountain Mama“ besang. Auf der Fahrt denke ich an das Gespräch mit Beth Macy. Ihre Anklage der Pharmaindustrie wird inzwischen in den USA breit geteilt. Über tausend Gerichtsverfahren wurden gegen die Familie Sackler, die Eigentümer von Purdue Pharma, eingeleitet.
Eine betäubte Gesellschaft
Doch Beths Argumentation erklärt nicht alles. Zum Beispiel den Anstieg von Selbstmorden und Alkoholismus unabhängig von Opiaten, die sich oft auf dieselben Gegenden konzentrieren. Außerdem vernachlässigt sie die Rolle, die persönliches Leid in der Angelegenheit spielt: Bei allen Betroffenen, die ich interviewte, kamen eine schwierige Kindheit, Ängste und Depressionen zum Vorschein. Sicher hat die übermäßige Verfügbarkeit von Opiaten verheerende Schäden in den Problemgemeinden angerichtet, die Beth Macy verteidigt. Doch warum wurden die Substanzen überhaupt eingenommen? Warum dieser allgemeine Ansturm auf Psychopharmaka, angefangen von Mitteln gegen Angststörungen wie Xanax bis hin zu starken synthetischen Opioiden wie Fentanyl?
„Genau das ist die Frage, doch niemand stellt sie!“, meint Michael Brumage, Arzt in Charleston, West Virginia, aufgebracht. „Was treibt die Leute dazu, aus der Realität flüchten zu wollen? Man beschäftigt sich so sehr mit den direkten Ursachen der Epidemie, dass diese grundsätzliche Frage nicht mehr gestellt wird.“ Für den Experten in medizinischer Vorsorge und ehemaligen Leiter des Büros für die regionale Anti-Drogen-Politik liegt der Schlüssel des Problems in den „sozialen Determinanten von Gesundheit“ – ein Begriff, den die Weltgesundheitsorganisation benutzt, um den Fokus auf die Bedeutung des sozialen Umfelds für die Gesundheit zu lenken statt nur auf individuelle Risikofaktoren. Über die sozialen Bedingungen, die zum Phänomen des „Todes aus Verzweiflung“ beitragen könnten, hat Brumage, der selbst aus einem Bergarbeiterstädtchen im Norden des Bundesstaats stammt, eine Menge zu sagen: „Solange die Bergwerke funktionierten, teilten die Familien dasselbe Schicksal, sie kämpften gemeinsam. Arbeit verschafft nicht nur ein Einkommen, sondern auch das Gefühl, in eine größere Gesellschaft eingebunden zu sein. Und somit ist der Verlust dieses Arbeitsplatzes auch ein Verlust von Sinn.“
Umso haarsträubender, dass das Elend der Arbeiter in den Appalachen politisch instrumentalisiert wird – durch Donald Trump, dessen Schatten unvermeidlich über der Diskussion schwebt: Genau in diesen abgehängten Gemeinden in West Virginia wurde Trump gewählt (mit 68 Prozent der Stimmen bei der letzten Präsidentschaftswahl). Er versprach ihnen ein neues Kohlezeitalter. Brumage nennt Trumps Namen nicht, meint jedoch ihn, als er seinem Ärger Luft macht. Dann kommt er auf die gesellschaftlichen Veränderungen zurück, die er für die entscheidenderen Gründe der Epidemie hält: „Ich bin 1959 geboren. Ich erinnere mich an Sommerabende auf der Veranda, man plauderte mit Nachbarn … Dann breitete sich das Fernsehen aus, Klimaanlagen wurden in Häuser eingebaut. Und schließlich kamen diese Massenzerstreuungswaffen hier“, er wedelt mit seinem Smartphone, „und die Leute begannen, sich zurückzuziehen. Ich denke nicht, dass Individualisierung ein Übel ist, aber sie erreicht ein extremes Niveau: Man verlässt sich nicht mehr auf die Unterstützung der anderen, man ist sozial vereinzelt.“ Würde dies also die „Tode durch Verzweiflung“ erklären? „Es sind verschiedene Erscheinungsformen desselben Missstands“, stellt Brumage klar, „und darum sucht man nach Mitteln, um die Wirklichkeit zu verändern, indem man sich durch Drogen oder andere riskante Verhaltensweisen betäubt.“
Hauptstadt der Überdosis
Individuelles Leid als einen gesellschaftlichen Tatbestand zu betrachten, war der Ansatz des französischen Soziologen Émile Durkheim, Autor des Buches Der Selbstmord (1897) – eine Pionierarbeit zu diesem Thema. In seiner von Industrialisierung und wissenschaftlichem Fortschritt geprägten Epoche entdeckt er, dass der Selbstmord „im umgekehrten Verhältnis zum Integrationsgrad der Kirche, der Familie und des Staates“ steht. Mit anderen Worten: Die Resilienz ist umso größer, je stärker man sich mit einer Gruppe oder einem Gegenstand verbunden fühlt, der uns übersteigt. Wir Menschen sind so gebaut, „dass es für unser Handeln ein Ziel geben muss, das darüber hinausgeht (…), es liegt in unserer ganzen moralischen Substanz und es kann sich nicht einmal teilweise verflüchtigen, ohne dass das Überleben im gleichen Maß an Berechtigung verliert“, erklärt Durkheim.
Hier zeichnet sich ein „dialogisches“ Verständnis von Identität ab, wie es heute der kanadische Philosoph Charles Taylor (*1931) vertritt: Identität entsteht ihm zufolge in Bezug auf gemeinsame Bedeutungshorizonte, die über das Ich hinausgehen. Deren Auflösung sei einer der großen Missstände der Moderne (The Malaise of Modernity lautet der Titel eines seiner Bücher, das 1992 erschien). Gegen das „monologische“ Ideal einer Identität, die sich frei selbst bestimmt, betont Taylor die Bedeutung dessen, was der amerikanische Philosoph George Herbert Mead (1863–1931) „signifikante Andere“ nannte – unsere Eltern beispielsweise –, deren Anerkennung uns wichtig ist. Die Auslöschung dieses Dialogs mit den anderen muss das Individuum teuer bezahlen. „Die Zufälligkeiten seiner privaten Existenz, die dem Anschein nach unmittelbar die Idee zum Selbstmord eingeben und die meist als bestimmende Ursachen angesehen werden, sind in Wirklichkeit nur äußerliche“, so Durkheim weiter. „Wenn das Individuum bei der geringsten Erschütterung der Umwelt die Waffen streckt, dann deswegen, weil es durch den Zustand der Gesellschaft zur leichten Beute für den Selbstmord wird.“
Nirgendwo schreien diese Zustände mehr zum Himmel als im Ghetto von Huntington, West Virginia, der „Hauptstadt der Überdosis“ mit 152 Opfern im Jahr 2017. Hier treffe ich Justin Ponton: „Ich tue, was ich kann, damit man uns als Hauptstadt des Drogenausstiegs sieht“, sagt der 30-Jährige mit schleppender Stimme und müdem Gesicht, den Blick auf sein Handy gerichtet. Er hat an diesem Sonntagmorgen bereits etwa 30 verzweifelte Anrufe entgegengenommen, und das ist erst der Beginn des Tages bei Newness of Life, dem Übergangswohnheim für Drogenabhängige, dessen Leiter er ist. Zwischen zwei Anrufen, zusammengesunken auf einer Couch im Eingangsbereich, erzählt mir Justin, wie er selbst es geschafft hat, aus dem Sumpf von Kriminalität und Drogen herauszukommen und seinem Leben eine Wendung zu geben: „Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass man die Beziehungen zwischen den Individuen stärken muss, lernen muss, sie zu verstehen und zu lieben. Alles beruht auf Beziehungen.“ Seine kleine Gemeinschaft funktioniert wie eine Uhr: Wenn sie nicht arbeiten, teilen sich die Bewohner die häuslichen Pflichten und helfen sich gegenseitig. Vor dem großen Backsteingebäude in einer heruntergekommenen Straße, wo die meisten Häuserfassaden bröckeln, bereiten Leute das Mittagessen am Grill vor. Ehe er sich zu ihnen gesellt, verrät Justin mir das Geheimnis, wie der Drogenausstieg gelingen kann: „Man muss etwas finden, das größer ist als man selbst. Und dann muss man daran arbeiten, zusammen mit anderen.“
Im Herzen des „Suicide Belt“
Männer, Frauen und Kinder laufen in einem Demonstrationszug vor der Silhouette der Berge und einem endlosen, blauen Himmel. Manche plaudern, andere schweigen. Viele tragen auf ihren T-Shirts den Namen eines Angehörigen, manchmal daneben ein Foto und eine kurze Beschreibung (Sohn, Bruder oder Onkel) und zwei Daten – das Geburtsund das Todesdatum. Zu beiden Seiten des Weges Schilder, die Mut und Hoffnung geben sollen, etwa „Bleibt stark“, „Reden rettet Leben“ oder ein Zitat des amerikanischen Dichters Walt Whitman (1819–1892): „Richte dein Gesicht stets zur Sonne und die Schatten werden hinter dich fallen.“
Wir befinden uns in East Helena, einer im Bundesstaat Montana gelegenen Ortschaft mit etwa 2000 Einwohnern, und die Menschen, die hier demonstrieren, tun dies, um ein Tabu zu brechen. Montana nimmt den obersten Platz im „Suicide Belt“ im Great American West ein. Es ist der Bundesstaat mit der drittgeringsten Bevölkerungsdichte, jedoch zugleich mit den meisten Selbstmorden. Zwei Fakten, die miteinander korrelieren, glaubt man den Experten, mit denen ich sprach. Sie betonen auch das raue Klima und die hohe Zahl von Waffenbesitzern. Doch sie können nicht recht erklären, wie es zu den Entwicklungen der letzten Jahre kam: Zwischen 1999 und 2016 stieg die Zahl der Selbstmorde in Montana um 38 Prozent, noch schneller als im Rest der USA, wo sie um 25 Prozent wuchs.
Ein etwa 40-jähriger Mann läuft neben mir. Er zeigt mit dem Finger auf den Horizont und erzählt mir die Geschichte dieses Ortes: „Diese Berge sind voller Schätze! Montana ist das Land der Schätze. Bei uns war es Blei. Damals haben die Leute die Erde auf Maultiere geladen und zur Bleihütte gebracht, um sie zu verkaufen. So entstand eine Gemeinde von tausend Menschen rund um die Erzhütte und sie war fest zusammengeschweißt. Man aß gemeinsam, kaufte beim Nachbarn ein. Alle kannten sich.“ Die Teilnehmer des Gedenkmarschs tragen Perlenketten: Lila für einen verlorenen Angehörigen, rot für den Verlust eines Ehegatten, grün für alle, die Selbstmord begingen. Der Mann neben mir heißt James Schell. Er ist der Bürgermeister von East Helena und er trägt Halsketten in allen drei Farben. Darum liegt es ihm auch so sehr am Herzen, eine Lösung zu finden. „Im Jahr 2000 schloss die Bleihütte und wir haben all das verloren“, erzählt er. „Wie also lässt sich dieser Gemeinschaftssinn wiederherstellen? Mit Events wie diesem, indem man mit Menschen auf der Straße spricht, aber auch indem man Wanderwege anlegt oder Angelgebiete.“ Seit elf Jahren nun versucht James im Park einen Pavillon zu errichten, „etwas ganz Einfaches: drei Meter hoch, zehn Meter lang, mit Betonboden und Elektroanschluss, um Musik machen zu können. Ich will, dass die Jugendlichen von ihren Handys wegkommen. Ich fände es schön, wenn sie mehr mit ihren Freunden und Familien unternehmen.“
Cowboy-Mentalität
Von Louisiana bis Montana fällt mir überall die Begeisterung der Amerikaner für ihre Autos auf. Darum auch die Kultur des „Drive-Thru“, wo man alles erledigen kann, ohne je sein Auto zu verlassen: vom Einkaufen übers Essen bis hin zu Bankgeschäften. Die Einkaufsstraßen der kleinen und mittleren Städte sehen im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl erstaunlich leer aus. Diesen Eindruck macht auf mich auch die Hauptstadt Montanas, Helena, wo ich meinen letzten Interviewpartner in einer diskreten Ecke eines Cafés treffe. Er ist Sohn eines Vaters, der die Familie im Stich ließ, und einer Mutter, die „immer beschäftigt“ war. Evan Kelly verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit damit, alleine im Wald Football zu spielen, bis er ein Stipendium erhielt, um professionell zu trainieren. Ein Sehnenriss in der Wade zwang ihn dazu, seine Karriere im American Football aufzugeben, und er fühlte sich am Ende seiner Kräfte: „Es war am Nachmittag, kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ich saß am Bettrand, meine Pistole lag da auf dem Nachttisch und ich fühlte mich völlig allein. Es war schönes Wetter an dem Tag, doch das änderte nichts: Ich wollte, dass der Schmerz aufhört.“
Der muskulöse Ingenieur trägt keine bunte Perlenkette, sondern eine Neun-Kaliber-Pistolenkugel als Kettenanhänger zur Erinnerung: „Es gibt diesen Moment, den man ,Wand‘ nennt: Du legst den Finger an den Abzug und er krümmt sich und krümmt sich und … dann hält er plötzlich inne. Du bist am Ende dieses Handgriffs angekommen und bei der kleinsten Bewegung geht der Schuss los.“ In letzter Sekunde erinnert sich Evan an eine Ex-Freundin, der er versprochen hatte, „das“ niemals zu tun, und er merkt, dass es irgendwo jemanden gibt, dem er etwas bedeutet. Mit Tränen in den Augen fährt er fort: „Hier gibt es diese Cowboy-Mentalität: Auch wenn du hart zu kämpfen hast, so hast du nicht das Recht, es zu zeigen. Ich verstand, dass ich so nicht weitermachen konnte. Also habe ich mich einem Freund anvertraut, dann anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und das hat mir sehr geholfen.“
Doch es wäre verfehlt, bei einem so komplexen Phänomen wie dem „Tod aus Verzweiflung“ die ebenso wichtigen ökonomischen und politischen Zusammenhänge außer Acht zu lassen. Zweifellos gibt es eine Verbindung zwischen riskantem Verhalten und Traumatisierungen in der Kindheit, wie es die Untersuchungen über Adverse Childhood Experiences zeigen, die in den USA in den 1990er-Jahren durchgeführt wurden. Auch von den Betroffenen, die ich interviewte, lebte keiner in einem stabilen familiären Umfeld. Doch es scheint, als würden diese individuellen Leidensgeschichten durch ein allgemeines Gefühl der Vereinzelung gesteigert. Aufmerksame Beobachter der amerikanischen Gesellschaft haben auf diese Tendenz hingewiesen, angefangen beim Politologen und Harvard-Professor Robert Putnam (*1941), der im einsamen Bowling-Spieler das Sinnbild für den Niedergang des „sozialen Kapitals“ sieht, bis hin zum Religionssoziologen Robert Wuthnow (*1946), der das Aufkommen eines Evangelikalismus beobachtet, der die individuelle Suche in den Mittelpunkt stellt und zulasten religiöser Gemeinschaften mit stärkeren Strukturen geht.
Gegen die Zersplitterung
„Diese ganze Geschichte erinnert an Durkheim“, stimmt Sir Angus Deaton zu, den ich an der Universität Princeton (New Jersey) treffe. Allerdings betont er vor allem die wirtschaftlichen Umwälzungen, die seiner Meinung nach am Anfang dieser Zersplitterung standen: „Der Verlust des Zusammenhalts ist enorm“, fügt seine Ehefrau und Kollegin Anne Case hinzu. Sie zitiert eine Umfrage, die die amerikanischen Gesundheitsbehörden (CDC) jährlich durchführen: „Von Jahr zu Jahr sagen die Amerikaner, dass ihnen das gesellige Miteinander mit ihren Freunden immer schwerer fällt. Alle Beziehungen, die sie dank ihrer Arbeit, ihrer Kirche, ihrer Familie aufgebaut haben, lösen sich auf. Und wir meinen, dass die Individuen dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Manche wenden sich Drogen zu, manche trinken, andere isolieren sich komplett und töten sich dann mit einer Schusswaffe oder einem Strick.“ Und andere setzen dieser Tendenz etwas entgegen. Wie die Frauen im Café Appalachia in Charleston, einem Vereinscafé, das in einer Kirche eingerichtet wurde, die niemand mehr besuchte. Ein neu geschaffener Ort der Gemeinschaft für alle, die es am nötigsten haben.
Die Angestellten sind Drogenabhängige auf dem Weg der gesellschaftlichen Wiedereingliederung. Im Kontakt mit der wohlwollenden Kundschaft aus der lokalen Bevölkerung erlangen sie ein Gefühl der Zugehörigkeit zurück. „Man nimmt Drogen vor allem, weil man das Gefühl hat, nicht an seinem Platz zu sein“, gesteht Autumn, eine 30-Jährige mit roten Haaren, die Küchenchefin ist. „Ich hatte früher nie verlässliche Beziehungen, darum ist es wichtig, Menschen zu haben, die sich um dich kümmern – und unsere Kundschaft macht uns so viel Mut.“ Ihre Kollegin Hollie schätzt die Geselligkeit im Café Appalachia: „Wir leben in einer Gesellschaft, die immer schneller wird. Aber hier kann man stundenlang sitzen, Leute treffen und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen.“ Während sie an der Stelle, wo früher der Altar stand, zusammen kochen, fühle ich wieder jene warmherzige Stimmung, die ich während meiner Reise mehrmals verspürt habe, vor allem während des kollektiven Gedenkmarschs in East Helena.
Hier zeigt sich der andere Aspekt des Phänomens, auf den Durkheim hingewiesen hatte, dass nämlich in Kriegszeiten die Selbstmordrate paradoxerweise gegen null tendiert: „Nicht also der Krise selbst danken wir den von uns festgestellten heilsamen Einfluss“, schrieb der Soziologe, „sondern den Kämpfen im Gefolge dieser Krisen. Wenn alle Menschen zusammenstehen müssen, um einer gemeinsamen Gefahr die Stirn zu bieten, dann denkt der Einzelne weniger an sich selbst und mehr an die gemeinsame Sache.“ Amerika ist im Kriegszustand – einem Krieg gegen die dreifache Epidemie von Drogen, Alkohol und Suizid – und in allen Teilen des Landes machen Tausende Amerikaner mobil. Der Journalist David Brooks (*1961) spricht von einer Bewegung von „Webern“, die das Geflecht des sozialen Zusammenhalts neu knüpfen. Nach 60 Jahren entfesseltem Individualismus bilden diese Menschen inzwischen eine kritische Masse: Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es möglich ist, jene menschlichen Beziehungen neu zu knüpfen, die dem Leben erst Sinn verleihen. Seit zwei Jahrhunderten feiern die Amerikaner jedes Jahr am 4. Juli den Tag der Unabhängigkeit. Es wäre nun an der Zeit, ihre gegenseitige Abhängigkeit zu feiern.•
Weitere Artikel
Gibt es eine moralische Pflicht, sein Kind impfen zu lassen?
Auch in Deutschland gibt es immer wieder Todesfälle, allein in diesem Jahr sind bereits mehr als 1000 Menschen an Masern erkrankt. Verhält sich, wer seinem Kind den Piekser erspart, asozial?

Ulrike Herrmann: „Es läuft auf grünes Schrumpfen hinaus, nicht auf grünes Wachstum“
Klimaschutz durch „grünes Wachstum“ hält die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann für eine Illusion. Damit das Ende des Kapitalismus keine Katastrophe wird, so ihre These, brauchen wir eine Wirtschaft nach dem Vorbild der britischen Kriegswirtschaft von 1939.

Überwinde dein Wollen
Im nordindischen Bodhgaya soll Buddha zur Erleuchtung gelangt sein. Mittlerweile strömen zahllose Menschen aus dem Westen hierher, um durch die Vipassana-Meditation ihren inneren Frieden zu finden. Unser Reporter machte sich mit dieser asketischen Technik vertraut, die Entspannung und Kasteiung gleichermaßen verspricht

Gewalt als einziges Ventil?
Seit dem Tod von Nahel M., der am 27. Juni von einem Polizisten erschossen wurde, gibt es in ganz Frankreich Unruhen. In Nanterre, westlich von Paris, sieht ein Teil der Jugendlichen Gewalt als einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Unser Reporter hat die Stimmung in der Cité Pablo Picasso eingefangen.

Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
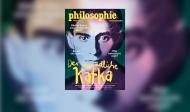
Kurt Cobain, der Selbstmörder der Gesellschaft
Vor dreißig Jahren nahm sich der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana mit einem Kopfschuss das Leben. Kurt Cobain, der eines der meistverkauften Alben aller Zeiten geschrieben hatte, verkörperte quasi im Alleingang eine Philosophie und eine Musikrichtung, die ebenso prägend wie kurzlebig war: den Grunge. Wer war dieser charismatische Rocker, der die Welt auf seine eigene Art verändert hat?
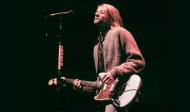
Warum sind wir gern im Garten?
Die Natur erwacht, alles grünt und auch das Unkraut schießt aus jeder Ritze. Vier Positionen, warum es uns mit Hacke und Heckenschere trotzdem in die Beete zieht
Klimaleugnung als Hyper-Wissenschaft
Seit den Bränden in Kalifornien schießt die Neue Rechte gegen jede Verbindung zur Klimakatastrophe. Der Diskurs, auf dem sie aufbaut, ist dabei nicht direkt anti-wissenschaftlich, sondern hyper-wissenschaftlich. Das erst macht ihn so richtig gefährlich.
