Wo sind wir zu Hause?
Daheim zu sein, verspricht Geborgenheit und Wärme. Aber wo finden wir unser Sehnen nach einem Zuhause erfüllt? Drei philosophische Positionen.
In verräumlichten Erinnerungen
Gaston Bachelard (1884 – 1962)
Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, nicht nur zu den geliebten Menschen, sondern auch zu den unveränderten Orten seiner Kindheit zurückzukehren? Diese Verbindung zwischen dem Gefühl von Geborgenheit und seinen räumlichen Bedingungen ist für den Phänomenologen Bachelard in seiner Poetik der Räume entscheidend. Denn das Zuhause ist der Ort, an dem unsere Erinnerungen „untergebracht“ und „verdichtete Zeit gespeichert“ ist. Sei es der vertraute Blick aus dem Fenster, das Knarren der Treppe oder das Versteck unter dem Bett – die Orte unserer Kindheit prägen uns für den Rest unseres Lebens. Und wie sehr uns dort auch manchmal die Decke auf den Kopf zu fallen droht und es uns in die Ferne zieht, in unseren Träumen, so Bachelard, kehren wir in diese „tröstlichen Räume“ zurück.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Daniel Schreiber: „Wir sollten das Zuhause-Gefühl in die Gegenwart bringen“
Wann fühlen wir uns zu Hause? Und kann es nach einer Flucht noch ein Zuhause geben? Daniel Schreiber im Gespräch über die Verortung des Menschen, die Herkunft der Heimatgefühle und die Bedeutung des Sozialen.

Brauchen wir Intimität?
Die meisten Menschen sehnen sich danach, einige fürchten sie. Doch sind wir wirklich so sehr auf intime Beziehungen angewiesen? Hier drei philosophische Positionen.

Das große Glück der unerfüllten Sehnsucht
Hoffnungen sind dazu da, erfüllt zu werden? Die melancholische Hoffnung – auch genannt romantische Liebe – legt das Gegenteil offen: Erfüllte Hoffnungen sind zum Weglaufen. Zum Bleiben bewegt den Melancholiker nur das fortgesetzte Sehnen.

Warum verschicken wir kitschige Postkarten?
Vorne Kitsch, hinten Floskeln. Gerade jetzt verschicken wieder Tausende Menschen Postkarten an die Daheimgebliebenen. Doch warum eigentlich? Harry Frankfurt, Pierre Bourdieu und Jacques Derrida geben Antworten.

Hartmut Böhme: „Die Vernunft hat kein Feuer, kein Licht, keine Wärme“
Kants Philosophie lebt von der Ausgrenzung der Affekte. Die Lust kommt nur als Störfaktor vor – mit fatalen Konsequenzen, argumentiert der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme im Gespräch.

Wie schaffen wir das?
Eine Million Flüchtlinge warten derzeit in erzwungener Passivität auf ihre Verfahren, auf ein Weiter, auf eine Zukunft. Die Tristheit und Unübersichtlichkeit dieser Situation lässt uns in defensiver Manier von einer „Flüchtlingskrise“ sprechen. Der Begriff der Krise, aus dem Griechischen stammend, bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Lage mit offenem Ausgang – und so steckt in ihm auch die Möglichkeit zur positiven Wendung. Sind die größtenteils jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen, nicht in der Tat auch ein Glücksfall für unsere hilf los überalterte Gesellschaft? Anstatt weiter angstvoll zu fragen, ob wir es schaffen, könnte es in einer zukunftszugewandten Debatte vielmehr darum gehen, wie wir es schaffen. Was ist der Schlüssel für gelungene Integration: die Sprache, die Arbeit, ein neues Zuhause? Wie können wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, einbinden in die Gestaltung unseres Zusammenlebens? In welcher Weise werden wir uns gegenseitig ändern, formen, inspirieren? Was müssen wir, was die Aufgenommenen leisten? Wie lässt sich Neid auf jene verhindern, die unsere Hilfe derzeit noch brauchen? Und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Mit Impulsen von Rupert Neudeck, Rainer Forst, Souleymane Bachir Diagne, Susan Neiman, Robert Pfaller, Lamya Kaddor, Harald Welzer, Claus Leggewie und Fritz Breithaupt.
Die neue Sonderausgabe: Die Kunst des Nichtstuns
Wir leben in einer Gesellschaft der Tätigen und sehnen uns nach Ruhe. Wie sähe ein Leben aus, in dem wir schamlos faulenzten, der Stille lauschten und Gelassenheit kultivierten? Wo und wie finden wir Muße? Und kann im Müßiggang nicht auch eine Form der Gesellschaftskritik verborgen sein? Nichtstun ist eine Kunst mit utopischem Potenzial. Es lohnt, sich in dieser zu üben.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
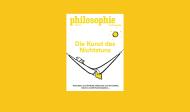
Hat Deutschland im Rahmen der Flüchtlingskrise eine besondere historisch bedingte Verantwortung
Während viele Deutsche nach 1945 einen Schlussstrich forderten, der ihnen nach der Nazizeit einen Neubeginn ermöglichen sollte, ist seit den neunziger Jahren in Deutschland eine Erinnerungskultur aufgebaut worden, die die Funktion eines Trennungsstrichs hat. Wir stellen uns der Last dieser Vergangenheit, erkennen die Leiden der Opfer an und übernehmen Verantwortung für die Verbrechen, die im Namen unseres Landes begangen worden sind. Erinnert wird dabei an die Vertreibung, Verfolgung und Ermordung der Juden und anderer ausgegrenzter Minderheiten. Dieser mörderische Plan konnte nur umgesetzt werden, weil die deutsche Mehrheitsgesellschaft damals weggeschaut hat, als die jüdischen Nachbarn gedemütigt, verfolgt, aus ihren Häusern geholt, deportiert wurden und für immer verschwunden sind. Weil den Deutschen über Jahrhunderte hinweg eingeprägt worden war, dass Juden radikal anders sind und eine Bedrohung darstellen, kam es zu diesem unfasslichen kollektiven Aussetzen von Mitgefühl.