Tod als Mittel zum Zweck?
Durch Hinrichtungen von Demonstranten will das Regime im Iran den Freiheitswillen des eigenen Volkes brechen. Dabei erläuterte Cesare Beccaria bereits im 18. Jahrhundert, warum die Todesstrafe unnütz ist.
„Auch wegen des Beispiels der Grausamkeit, das sie den Menschen bietet, ist die Todesstrafe nicht nützlich. Wenn schon die Leidenschaften oder die Notwendigkeit des Krieges gelehrt haben, menschliches Blut zu vergießen, so sollten doch die Gesetze, die menschliches Verhalten lenken, das Beispiel der Wildheit nicht verstärken, das umso düsterer ist, als die gesetzliche Tötung mit Bedacht und mit Förmlichkeit vollzogen wird. Es erscheint mir widersinnig, daß die Gesetze, die Ausdruck des öffentlichen Willens sind und Tötungen mißbilligen und bestrafen, selber eine begehen und, um die Bürger vom Mord abzuhalten, einen öffentlichen Mord anordnen. (…) Welches sind die Empfindungen von jedermann über die Todesstrafe? Wir lesen sie aus den verächtlichen und mißbilligenden Verhaltensweisen, mit denen jeder dem Henker begegnet, der doch ein unschuldiger Vollstrecker des öffentlichen Willens ist, ein guter Bürger, der seinen Beitrag zum Gemeinwohl erbringt, das nothwendige Werkzeug der öffentlichen Sicherheit nach innen, wie es die tapferen Soldaten nach außen sind. Wie entsteht also dieser Widerspruch? (…) Weil die Menschen im Innersten ihrer Seele (…) immer geglaubt haben, daß das Leben selber in niemandes Gewalt steht außer in derjenigen der Notwendigkeit, die mit ihrem eisernen Szepter das Weltall regiert.“
Cesare Beccaria: „Von den Verbrechen und von den Strafen“ (1764). Übersetzt v. Thomas Vormbaum. Berlin 2005. S.54f.
Cesare Beccaria (1738-1794) war ein italienischer Philosoph und Kriminologe, der vor allem für seine oben genannte Abhandlung bekannt ist. In diesem Werk plädierte Beccaria für die Abschaffung der Folter und der Todesstrafe sowie für eine Reform des Strafrechtssystems, die auf den Grundsätzen der Rationalität und Menschlichkeit beruhen sollte. Beccarias Schaffen hatte erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Strafrechts und der Strafjustiz in Europa und den Vereinigten Staaten und beeinflusst auch heute noch das Denken in diesen Bereichen.
Weitere Artikel
Thomas von der Osten-Sacken: „Die Islamische Republik Iran ist ein sterbendes Regime“
Seit einer Woche sind die Menschen im Iran von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist von starken Repressionen und Massakern angesichts anhaltender Massenproteste gegen das Regime auszugehen. Thomas von der Osten-Sacken erklärt, inwiefern die Proteste sich von bisherigen unterscheiden, und blickt auf die Chancen der iranischen Opposition.

Donatella Di Cesare: „Es gibt keine Demokratie ohne Gastfreundschaft“
Gastfreundschaft gilt oft als Maßstab für eine humanere Migrationspolitik. Zu Recht? Die italienische Philosophin Donatella Di Cesare erklärt, warum wahre Demokraten die Welt nicht in Gastgeber und Gäste einteilen und was sich mit Aischylos und Derrida dennoch aus dem Konzept lernen lässt.

Donatella Di Cesare: „Wir müssen Bürgerschaft als Fremdheit denken“
Die Europäische Union plant eine Asylreform, die für Donatella Di Cesare nicht nur ein Verrat an der europäischen Idee ist, sondern auch eine Fortführung der Blut-und-Boden-Ideologie. Die Philosophin fordert statt einer Politik nationalstaatlicher Souveränität ein neues Denken der Bürgerschaft. Über die Möglichkeiten einer solchen Veränderung sprachen wir mit ihr am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover.

Sina Abedi: „Dieser Konflikt ist nicht der des iranischen Volkes“
Drei Tage nach Beginn der von Israel gegen den Iran gestarteten Operation „Rising Lion“ haben wir den promovierten Architekten, Forscher, Dozenten und Essayisten Sina Abedi interviewt. Er erklärt uns, dass das iranische Volk beide Kräfte gleichermaßen ablehnt, zwischen denen es sich als Geisel wiederfindet: die Islamische Republik und die israelische Regierung.

Der Iran in der Revolte
Auf die anhaltenden Proteste im Iran reagiert der iranische Staat mit immer mehr Todesurteilen. Schon Albert Camus hatte zwischen „Revolution“ und „Revolte“ unterschieden: Während Erstere den Menschen opfert, stellt ihn Zweitere in den Mittelpunkt.

Kamala Harris, eine Deweyanerin?
In der ersten Rede, die Kamala Harris jüngst als gewählte Vize-Präsidentin der Vereinigten Staaten hielt, erläuterte sie en passant ein Verständnis von Demokratie, das stark an die Philosophie John Deweys erinnert, einen der wichtigsten Denker des amerikanischen Pragmatismus.

Kohei Saito: „Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind das neue Opium des Volkes“
Mit seinem Entwurf eines Degrowth-Kommunismus ist Kohei Saito in Japan ein Überraschungsbestseller gelungen, der sich über 500.000 Mal verkauft hat. Im Interview erläutert der Philosoph, warum das Klima innerhalb des Kapitalismus nicht zu retten ist, weshalb wir nicht auf die Revolution warten sollten und was die Aktivisten der Letzten Generation von Karl Marx lernen können.
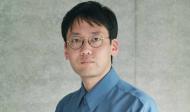
Volker Weiß: „Eine moderne Rechte weiß genau um die Grenzen der Nostalgie“
Weltweit haben es Rechtspopulisten wie Trump, Bolsonaro oder Orban auf den Geschichtsunterricht abgesehen. Ihr Ziel: Die Historie des eigenen Landes soll möglichst glorreich erscheinen. Woher diese ideologische Idealisierung der Vergangenheit rührt, worin ihr politisches Ziel liegt und warum derlei auch in Deutschland droht, erklärt Historiker Volker Weiß.

Kommentare
Darüber hab ich mir auch Gedanken gemacht: Vielleicht sollte auf einen Schuldspruch weniger eine "Strafe"(punishment) folgen und mehr eine Konsequenz bezüglich der Befreiungen, welche der Schuldige von Gesellschaften erhält, wobei eine gewisse überlebensnotwendige grundlegende Befreiung garantiert bleiben sollte. Je nach Schuld und Möglichkeiten könnte nur grundlegende Befreiung wie Essen, Heizung, Schutz, Nachtruhe plus diese oder jene geleistet werden, dazu Unterstützung zur Selbstverbesserung/Selbstreformation, weiterhin Leistung zur Verbesserung des Verhältnisses des Schuldigen zu seiner alten Welt und Leistung zur Verbesserung der alten Welt des Schuldigen.
Es scheint mir: Mancher Mensch tut sträflich, was eine Reduktion der für ihn geleisteten Befreiungen erfordern kann, mancher kann sich bessern, was gut für die Gesellschaft sein kann, die es sich leisten kann, dies zu ermöglichen und zu prüfen.