Dostojewski und die Schuld
Wer seine metaphysischen Krimis liest, blickt direkt in den Abgrund menschlichen Daseins. Für Dostojewski, der vor 145 Jahren gestorben ist, war das Gefühl der Schuld nie etwas Zufälliges, sondern die Grundlage aller Existenz selbst.
Albert Camus war ein großer Dostojewski-Leser: In seinem Buch Der Fall erwähnt er eine mittelalterliche Folterzelle, die er „Un-Gemach“ (malconfort) nennt. Diese ist so eng, dass der darin lebenslänglich Gefangene weder aufrecht stehen noch liegen kann. Mit diesem Bild führt uns Camus das erdrückende Leid der Schuld vor Augen: Es ist schwierig, mit dem Gefühl fertig zu werden, nicht richtig geliebt, schlecht gehandelt, etwas schlecht gemacht zu haben. Wir glauben, uns als moderne Menschen von alten Autoritäten – Göttern, Vätern, Traditionen – befreit zu haben, indem wir sie infrage stellten, leugneten, ja „umbrachten“. Doch die Schuld, die wir damit zur Tür hinausbefördert zu haben meinten, ist zum Fenster wieder hereingekommen. Denn der Versuch, die großen Anderen hinauszuwerfen, war vergeblich. Umso mehr schämen wir uns vor den „kleinen Anderen“ und uns selbst. Sind wir der Größe unseres Begehrens gewachsen? Sind wir des Vertrauens unserer Nächsten, unserer Kollegen, der Gesellschaft würdig? Warum war man heute Morgen so gestresst und hat sich den Tag dadurch verdorben, dass man immer wieder daran gedacht hat? Es ist eine Eigenheit der Schuld, dass sie sich selbst nährt.
Echte und imaginäre Verbrechen
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Jan Costin Wagner - Der Eiskalte
Jan Costin Wagner ist der Metaphysiker unter Deutschlands Krimiautoren. Seine Helden fahnden nicht nach Mördern, sondern nach dem Tod selbst. Wer trägt Schuld an unserer Sterblichkeit? Lässt sie sich aufklären? Philosophische Fragen, die vor allem Wagners finnischen Ermittler Kimmo Joentaa begleiten, wenn er sich im tiefsten Winter ein ums andere Mal in die Kälte des Daseins wagt.
Machen Krisen uns stärker?
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, formuliert Friedrich Nietzsche. Aber woran entscheidet sich, ob wir an Schicksalsschlägen scheitern – oder reifen? Was unterscheidet gesunde Widerständigkeit von Verdrängung und Verhärtung? Machen Krisen kreativer? Ermöglichen allein sie wahre Selbstfindung? Oder wären solche Thesen bereits Teil einer Ökonomisierung des Daseins, die noch in den dunkelsten Stunden unserer Existenz nach Potenzialen der Selbstoptimierung fahndet?
Wolfram Eilenberger legt mit Nietzsche frei, wie man existenzielle Krisen nicht nur überleben, sondern für sich nutzen kann. Ariadne von Schirach singt dagegen ein Loblied auf den Menschen als ewiges Mangelwesen, und im Dialog mit dem Kulturtheoretiker Thomas Macho sucht Roger Willemsen nach dem Gleichgewicht zwischen beschädigter Existenz und Liebe zur Welt.
Das Ende der Stellvertretung und die direkte Zukunft der Demokratie
Die repräsentative Demokratie lässt das Projekt der Aufklärung unvollendet. Statt selbst über unsere undelegierbaren Angelegenheiten zu entscheiden, setzen andere für uns Zwecke. Ein Plädoyer für den Ausbruch aus der institutionalisierten Unmündigkeit und mehr direkte Demokratie von Andreas Urs Sommer.

Wer ist mein wahres Selbst?
Kennen Sie auch solche Abende? Erschöpft sinken Sie, vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand, aufs Sofa. Sie kommen gerade von einem Empfang, viele Kollegen waren da, Geschäftspartner, Sie haben stundenlang geredet und kamen sich dabei vor wie ein Schauspieler, der nicht in seine Rolle findet. All diese Blicke. All diese Erwartungen. All diese Menschen, die etwas in Ihnen sehen, das Sie gar nicht sind, und Sie nötigen, sich zu verstellen … Wann, so fragen Sie sich, war ich heute eigentlich ich? Ich – dieses kleine Wort klingt in Ihren Ohren auf einmal so seltsam, dass Sie sich unwillkürlich in den Arm kneifen. Ich – wer ist das? Habe ich überhaupt so etwas wie ein wahres Selbst? Wüsste ich dann nicht zumindest jetzt, in der Stille des Abends, etwas Sinnvolles mit mir anzufangen?
„Ein Ventil für Ängste“
Es gibt kaum ein beliebteres Genre in der Literatur als Krimis. Wie denkt der derzeit erfolgreichste deutsche Verfasser von Psychothrillern Sebastian Fitzek über das Böse und unsere anhaltende Faszination dafür? Und was sagt es über ihn, dass er sein Leben dem Beschreiben von Verbrechen widmet?

Im Augenblick erwacht das Selbst
Alles, was ist, muss vergehen. In der japanischen Kultur wird diese Einsicht zur Grundlage eines Denkens, das absolute Gegenwärtigkeit als höchste Form des Daseins feiert. Wie genau, erklärt der Philosoph Yasuhiko Sugimura.
Verzeihen - Gibt es einen Neuanfang?
Wo Menschen handeln, entsteht Schuld. Und manchmal wiegt sie so schwer, dass kein Heil mehr möglich scheint. Was, wenn eine Schuld nie beglichen werden kann? Wie sich befreien aus der Fixierung auf etwas, das sich nicht mehr ändern lässt? Wer sich diese Fragen stellt, ist bereits in jenen Möglichkeitsraum eingetreten, den die Philosophie eröffnet. Das Verzeihen ist der Weg, das Gewesene zu verwandeln und neu zu beginnen: Darin waren sich Denkerinnen und Denker wie Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt und Paul Ricœur einig. Aber wie wäre er zu beschreiten, dieser Weg? Wo liegt die Grenze des Verzeihbaren? Und was wird aus dem berechtigten Ruf nach Gerechtigkeit? Ein Dossier mit Impulsen für die Zurückgewinnung der Zukunft.
Schleiermacher und die Religion
Was ist Religion? Ein Gebilde aus metaphysischen Glaubenssätzen über die Existenz und das Wirken Gottes? Für Friedrich Schleiermacher geht es im Glauben um etwas anderes: eine besondere Weise, die Wirklichkeit zu erfahren.
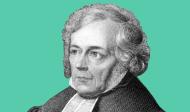
Kommentare
Herr Eltchaninoff,
Ihrer Essay ist nicht nur grandios und raffiniert geschrieben,.....er ist einfach brillant. Die Art und die Eleganz womit Sie den Schriftsteller und Freud zusammenbringen finde ich einfach genial.
Ich habe jede Zeile aufmerksam gelesen und den Aufbau des Diskurses sehr genossen.
Vielen Dank
Danke für den Beitrag und die Möglichkeit zu kommentieren.
Vielleicht kann man so an Schuld herangehen, dass man oft wahrscheinlich Gutes versucht, und damit vielleicht oft genug (oftmals statistisch erwartbare) Schuld begleichen kann, klein und groß, schnell und langsam.