Şeyda Kurt: „Wir sollten das Tabu brechen, über Hass zu sprechen“
Gefühle wie Hass haben es in der politischen Öffentlichkeit schwer. Die Autor*in Şeyda Kurt sieht das differenzierter. Im Gespräch erklärt Kurt, weshalb in manchen Formen des Hassens sogar progressives Potential liegt.
Şeyda Kurt, wird zu wenig gehasst?
Ich würde sagen, nein. Worum es mir in dem Buch geht, ist, den Hass aus der Versenkung zu holen und festzustellen, dass es ihn gibt. Wir sollten das Tabu brechen, über Hass zu sprechen. Damit meine ich nicht den Hass, über den in den letzten Jahren schon sehr viel gesprochen wurde, z. B. den rechten Hass von Pegida. Darüber schreibt zum Beispiel Carolin Emcke in ihrem Essay Gegen den Hass, in dem sie sich gegen diese rechten Bewegungen richtet. Worüber aber gar nicht gesprochen wird, ist der Hass von Menschen, die immer nur als Objekte des Hasses gehandelt werden. Menschen, die von Rassismus, von faschistischer Gewalt, von Misogynie und Queerfeindlichkeit betroffen sind. Ich denke, es kann sehr sinnvoll sein, mehr über einen strategischen, widerständigen Hass zu sprechen, der am Ende Zärtlichkeit hervorbringt. Aber ich würde in einem früheren Schritt behaupten: Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, diesen Hass unter die Lupe zu nehmen und überhaupt anzuerkennen, dass es ihn gibt, und dass er existiert.
Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, ein Buch über den Hass zu schreiben?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
„Hate Watching“: Warum sind wir fasziniert von dem, was wir hassen?
Wer kennt das nicht: Eine Realityshow anschauen, obwohl man sie albern findet; einem Filmsternchen in den sozialen Netzwerken folgen, das man verachtet; eine Serie bis zum Ende gucken, obwohl sie einen vor Langeweile gähnen lässt... Warum sind wir derart fasziniert von dem, was wir verabscheuen? Weil wir im Grunde genau das begehren, was wir angeblich hassen, antwortet René Girard.

Daniel Hornuff: „Hass ist eine Technik der Kommunikation“
Bei Debatten über Hass im Netz geht es oft um Sprache. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff betont in seinem gleichnamigen Buch jedoch auch die Bedeutung von Hassbildern. Warum diese oft zusammengeschustert aussehen, weshalb man nicht von „Shitstorm“ sprechen sollte und inwiefern sich hier historisch äußerst stabile Muster zeigen, erklärt er im Gespräch.

Kurt Cobain, der Selbstmörder der Gesellschaft
Vor dreißig Jahren nahm sich der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana mit einem Kopfschuss das Leben. Kurt Cobain, der eines der meistverkauften Alben aller Zeiten geschrieben hatte, verkörperte quasi im Alleingang eine Philosophie und eine Musikrichtung, die ebenso prägend wie kurzlebig war: den Grunge. Wer war dieser charismatische Rocker, der die Welt auf seine eigene Art verändert hat?
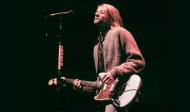
Moralische Minderwertigkeitskomplexe
Warum sehen sich engagierte Menschen im Netz oft mit blankem Hass konfrontiert? Weil die Hassenden ahnen, dass sie ein falsches Leben führen, argumentiert Matthias Kiesselbach.

Hass – Anatomie eines elementaren Gefühls
Im September letzten Jahres fand das 25. Philosophicum Lech zum Thema Hass statt. Anlässlich des nun erschienen Sammelbandes lesen Sie hier den Eröffnungsvortrag von Konrad Paul Liessmann.

Die gereizte Gesellschaft
Hasskommentare, Tabubrüche, politischer Extremismus: Die tiefe Krise der Demokratie spiegelt sich in der gegenwärtigen Diskurskultur. Oder ist die Ausweitung der Kampfzone ein gutes Zeichen? Der Medientheoretiker Bernhard Pörksen diskutiert mit der Philosophin Marie-Luisa Frick
Kann uns die Liebe retten?
Der Markt der Gefühle hat Konjunktur. Allen voran das Geschäft des Onlinedatings, welches hierzulande mit 8,4 Millionen aktiven Nutzern jährlich über 200 Millionen Euro umsetzt. Doch nicht nur dort. Schaltet man etwa das Radio ein, ist es kein Zufall, direkt auf einen Lovesong zu stoßen. Von den 2016 in Deutschland zehn meistverkauften Hits handeln sechs von der Liebe. Ähnlich verhält es sich in den sozialen Netzwerken. Obwohl diese mittlerweile als Echokammern des Hasses gelten, strotzt beispielsweise Facebook nur so von „Visual-Statement“-Seiten, deren meist liebeskitschige Spruchbildchen Hunderttausende Male geteilt werden. Allein die Seite „Liebes Sprüche“, von der es zig Ableger gibt, hat dort über 200 000 Follower. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich eine Liebesbotschaft auch ins Zimmer stellen. „All you need is love“, den Titel des berühmten Beatles-Songs, gibt es beispielsweise auch als Poster, Wandtattoo, Küchenschild oder Kaffeetasse zu kaufen.
Zu viel Gerede
Die Diskussionen auf Facebook, Twitter und Co. sind oft von Missgunst, Hass und Häme geprägt. Daran werden auch einzelne technische Neuerungen oder sogar die Zerschlagung von Tech-Konzernen nichts ändern. Es hilft nur, an die Wurzel allen Übels zu gehen: Es braucht eine Beschränkung unserer Online-Kontakte.

Kommentare
Wäre für den widerständigen Hass nicht der Begriff 'Trotz' angebrachter? Als Verweigerung der Zusammenarbeit mit Unterdrückern zur Verteidigung der Würde der Unterdrückten? Dem Hass an sich etwas Positives abzugewinnen halte ich für gefährlich, nicht selten sind aus Unterdrückten selbst Unterdrücker geworden.
Wäre für den widerständigen Hass nicht der Begriff 'Trotz' angebrachter? Als Verweigerung der Zusammenarbeit mit Unterdrückern zur Verteidigung der Würde der Unterdrückten? Dem Hass an sich etwas Positives abzugewinnen halte ich für gefährlich, nicht selten sind aus Unterdrückten selbst Unterdrücker geworden.