Leben und Werk im Widerspruch: Simone de Beauvoir
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Diesmal: Simone de Beauvoir, die trotz ihres feministischen Kampfes blind für die eigenen unterdrückerischen Taten war.
Ebenfalls in dieser Reihe lesen Sie: Martin Heidegger, Jean-Jacques Rousseau und Judith Butler
Simone de Beauvoir hat mit Das andere Geschlecht (deutsch 1951) einen Gründungstext der zweiten Welle des Feminismus vorgelegt. Das philosophisch-soziologische Werk zeichnet nach, wie Geschlecht als gesellschaftliche Kategorie Frauen in eine minderwertige Position zwingt. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass sie in den 1970er Jahren zusammen mit vielen anderen französischen Intellektuellen Petitionen unterschrieb, um die juristische Altersbeschränkung der Einwilligungsfähigkeit von Minderjährigen für sexuelle Handlungen abzuschaffen. Die Philosophin hatte zahlreiche Affären mit sehr jungen Frauen, die zum Teil ihre Schülerinnen waren. Wie kommt es zu diesem Widerspruch zwischen philosophischem Ideal und Lebensvollzug?
Simone de Beauvoir stand mit ihrem Denken für eine Philosophie der Freiheit. Eine Essenz oder ein Wesen des Menschen - so die Kernthese des Existentialismus, den sie zusammen mit Jean-Paul Sartre ausarbeitete – gibt es nicht. Vielmehr erschafft er sich durch sein Handeln in der Welt. Er ist frei, sich selbst zu erfinden und dabei stets neu zu übersteigen. Für Frauen ist dieser Freiheitsdrang ebenso grundlegend wie für Männer, sie werden aber durch ihre fremdbestimmte gesellschaftliche Position als „das Andere‟ immer wieder auf eine unfreie Daseinsform zurückgeworfen. Wie es dazu kam und wie sich die Frau davon befreien kann, ist das Thema von de Beauvoirs Hauptwerk. Sie richtet dabei einen äußerst genauen, sozialwissenschaftlichen Blick auf die Lebensrealitäten von Frauen und zeigt, wie ihnen in der patriarchalischen Gesellschaft eine Entfaltung ihrer Möglichkeiten verwehrt wird. Auch die Sexualität von jungen Mädchen wird sehr aufmerksam und komplex analysiert. De Beauvoir zeichnet ein Bild von in Widersprüchen verstrickten Geschöpfen, die zwar Begehren und Lust empfinden, keineswegs aber fähig sind, diese auf eine Art auszuleben, durch die sie nicht erniedrigt werden. Auch das erotische Erleben von erwachsenen Frauen ist bei de Beauvoir durch ihre gesellschaftliche Position zutiefst gespalten. Umso mehr gilt dies für junge Mädchen, die „keinen wirklichen Willen, sondern nur Wünsche‟ haben, und die die Folgen ihres Verhaltens für sich selbst nicht abschätzen können.
Man kommt nicht als Unterdrückerin zur Welt
Dass ein solches Mädchen im Besitz der „vollständigen Freiheit‟ sein könnte, welche eine der von de Beauvoir unterzeichneten Petitionen als „notwendige und hinreichende Bedingung‟ für sexuelle Handlungen benennt, erscheint vor diesem Hintergrund kaum vorstellbar. Wenn wir de Beauvoirs Beobachtungen und Kritik ernst nehmen, muss die Idee, dass ein Kind in der Lage sein könnte, sexuellen Handlungen mit einem oder einer Erwachsenen zuzustimmen, grotesk, ja verlogen erscheinen. Die Lösung, welche die Philosophin in Das andere Geschlecht für das sexuelle Dilemma der erwachsenen Frau vorschlägt, ist die Gleichheit der Geschlechter, welche durch die Anerkennung und die Verwirklichung der Freiheit der Frau erlangt werden soll. Eine solche Gleichheit in der Selbstwirksamkeit von Erwachsenen und Minderjährigen ist eine gänzlich andere Frage. Denn im letzteren Fall ist das Machtgefälle zwischen den Parteien nicht bloß gesellschaftlich konstruiert, sondern auch entwicklungspsychologisch angelegt. In Das andere Geschlecht ist dies sehr anschaulich nachzulesen. Wäre die Petition in einer Welt der restlosen Gleichheit und Freiheit der Geschlechter unterzeichnet worden – wovon natürlich nicht die Rede sein kann – auch dann wäre die „vollständige Freiheit‟ der Minderjährigen nicht gegeben. De Beauvoir wird dies gewusst haben, so wie sie, in Briefen und Interviews belegt, wusste, dass sie ihren jungen Liebhaberinnen aufgrund ihrer überlegenen Stellung, vom Altersunterschied nicht trennbar, auch Leid zugefügt hat.
Dass uns diese Eigennützigkeit bei de Beauvoir möglicherweise stärker aufstößt, als bei ihren männlichen Kollegen wie Jacques Derrida, Roland Barthes oder auch Sartre, die ebenfalls unterschrieben und, zumindest in Sartres Fall, ähnlich ausbeuterisch gehandelt haben, kann man als sexistischen Doppelstandard ansehen. Aber auch als Enttäuschung darüber, dass eine so scharfsichtige Kritikerin der zerstörerischen Unterdrückung eines Teils der Menschheit einem anderen Teil, das sich noch weniger wehren konnte, eher geschadet als gestärkt hat.
Millay Hyatt wurde in Dallas/Texas, USA geboren. Die promovierte Philosophin lebt als freie Autorin in Berlin. Ihr Reise-Essay „Nachtzugtage“ erscheint im August bei der Friedenauer Presse / Matthes & Seitz Berlin.
Weitere Artikel
Leben und Werk im Widerspruch: Jean-Jacques Rousseau
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Jean-Jacques Rousseau, der trotz seiner radikalen Erziehungsideale seine eigenen Kinder ins Waisenhaus gab.
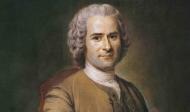
Leben und Werk im Widerspruch: Judith Butler
Auch bei Philosophen passt nicht immer alles zusammen. In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Judith Butler, die eine Ethik der Gewaltlosigkeit vertritt, aber den Terror der Hamas als „bewaffneten Widerstand“ bezeichnet.

Leben und Werk im Widerspruch: Martin Heidegger
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Zum Abschluss: Martin Heidegger, dessen Auseinandersetzung mit dem Sein in hartem Kontrast zu seinem Engagement für die seinsvergessenen Nationalsozialisten stand.

Leben und Werk im Widerspruch: Theodor W. Adorno
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Theodor W. Adorno, der sich am Ende seines Lebens auf die Seite des Staatsapparates stellte, den er vormals scharf kritisierte.

Simone Beauvoir und der Feminismus
Heute vor 115 Jahren kam Simone de Beauvoir zur Welt. Svenja Flaßpöhler erläutert in ihrem Essay einen zentralen Gedanken der Philosophin: Die wahre Freiheit der Frau liegt nicht darin, die Andersheit zu negieren, sondern sie in Kraft zu verwandeln.

Man kommt nicht als Beauvoir zur Welt
Dass Frauen seit jeher nicht „der Mensch“, sondern das „andere Geschlecht“ sind, hat niemand schonungsloser und wirkmächtiger analysiert und kritisiert als Simone de Beauvoir, die heute vor 117 Jahren zur Welt kam.

Beauvoir und das Kopftuch
Mit zusammengekniffenen Lippen und strengem Blick schaut Simone de Beauvoir in die Kamera.
Wolfram Eilenberger: „Philosophie kann direkt in die Existenz eingreifen“
Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand und Simone Weil: Das sind die Protagonistinnen in Wolfram Eilenbergers neuem Buch Feuer der Freiheit. Schon in Die Zeit der Zauberer, dem zum Weltbestseller avancierten Vorgänger, hatte Eilenberger Leben und Denken von vier Geistesgrößen zusammengeführt. Damals waren es Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger. Nun also vier Frauen, die ihr Denken in den finsteren 1930er und 40er Jahren entwickeln. Ein Gespräch mit dem Autor über ein Jahrzehnt, in dem die Welt in Scherben lag - und vier Philosophinnen, die die Freiheit verteidigten.
