Experten für Weltliebe
Fachleute sind besonders gut darin, eine düstere Zukunft zu beschwören: eine Welt ohne Frieden, Wahlen und Golfstrom. Wer das verhindern will, sollte vielleicht nicht immer auf die Schwarzmaler hören.
Die Funktion von Experten, sie scheint derzeit vor allem darin zu bestehen, Angst einzujagen. In der sommerlichen Hängematte, jüngste Gespräche auf und vor allem hinter den Bühnen noch lebhaft im Kopf, fiel es nicht leicht, die Balance zu wahren. Da war, zum Beispiel, der bekannte Professor für Geopolitik. Noch backstage erinnerte er mich an die Bemalung der ersten russischen Panzer gen Ukraine. „Na Берлин“, also „nach Berlin“ habe auf diesen gestanden. Wobei es, fügte er hinzu, ein schlichtes Gebot praktischer Vernunft sei, Menschen erst einmal zu glauben, was sie so von sich gäben.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die sichtbare Hand des Marktes
Es war keine utopische Spukgeschichte: Als Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem 1848 erschienenen Manifest jenes „Gespenst des Kommunismus“ beschworen, das Kapitalisten in Enteignungsangst versetzen sollte, war das für sie vielmehr eine realistische Zukunftsprognose. Denn Marx und Engels legten großen Wert darauf, dass es sich im Kontrast zu ihren frühsozialistischen Vorläufern hier nicht um politische Fantasterei, sondern eine geschichtsphilosophisch gut abgesicherte Diagnose handle: Der Weltgeist sieht rot.

Die Kluft zwischen Macht und Geist
Seit Gerhard Schröder sind Experten aus der Politik nicht mehr wegzudenken. Doch während der Altkanzler, der am Sonntag 80 wurde, in der Regel allein und aus dem Bauch heraus entschied, pflegen seine Nachfolger ein anderes Verhältnis zur Wissenschaft. Haben Experten nun die Macht?

Jan Slaby: „In-der-Welt-Sein ist deutlich mehr als Curlingsteine durch die Gegend schieben“
Die Liste der Dinge, die Künstliche Intelligenzen besser können als Menschen, wächst stetig. Nach Erfolgen in den Denksportarten wie Go und Schach hat ein Roboter nun erstmals Profispieler im Curling geschlagen. Manche Experten sehen darin einen Durchbruch für autonome KIs. Der Philosoph Jan Slaby ist hingegen skeptisch. Die Potentiale der Zukunft lägen vielmehr in hybriden Systemen.

Die Strömung und wir
Jüngst fanden Forscher heraus, dass sich die Geschwindigkeit des Golfstroms in den letzten 40 Jahre um 4 % reduziert hat. Bereits 1800 machte der Historiker Jules Michelet auf die Wichtigkeit von Meeresströmungen für das globale Klima aufmerksam.
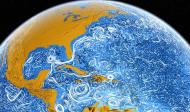
Die Geburt als philosophische Idee
Beim Hören von Händels Messias-Oratorium hat Hannah Arendt die Eingebung, dass sich die Philosophie – entgegen Heidegger – nicht der Sterblichkeit, sondern vielmehr der Natalität zuwenden sollte. Denn das Wunder besteht darin, geboren zu werden.

Israels aktueller Populismus
In ihrem jüngst erschienen Buch geht Eva Illouz den titelgebenden Undemokratischen Emotionen nach und stellt besonders die Angst als Gefährdung für ihr Heimatland Israel heraus. Eine Rezension von Josef Früchtl.

Das neue Feuer
Künstliche Intelligenz ruft oft zwei grundsätzlich unterschiedliche Reaktionen hervor: Euphorie ob all der utopischen Möglichkeiten. Oder Schwarzmalerei und das prophezeite Ende der Menschheit. Philosophisch besehen lässt sich allerdings ein differenzierteres Bild zeichnen.

Hans Ulrich Gumbrecht: „Trump ist nur ein Platzhalter für die Leute, die ihn finanziert haben“
Die Wiederwahl Trumps weckt Ängste. Der in den USA lehrende Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht hingegen sieht die wahre Gefahr in der zweiten Reihe und warnt vor einem radikalen Gesellschaftsumbau: Keine Steuern, keine Experten, keine Wahlen.
