Fundstück zur Wahl: „Mit dem Stimmzettel den Tod weglegen“
In seinem Hauptwerk Masse und Macht betont Elias Canetti die Transformationsleistung von Wahlen: Wo früher Heere gegeneinander kämpften, entscheidet heute die Mehrheit der Stimmen.
„Die Wahl des Abgeordneten ist im Prinzip den Vorgängen im Parlament verwandt. Als der beste unter den Kandidaten, als der Sieger gilt, wer sich als der Stärkste erweist. Der Stärkste ist der, der die meisten Stimmen hat. Würden die 17562 Menschen, die für ihn sind, als geschlossenes Heer gegen die 13204 antreten, die seinem Gegner folgen, sie müßten den Sieg erringen. Auch hier soll es nicht zu Toten kommen. Immerhin ist die Unverletzlichkeit der Wähler nicht so wichtig wie der Stimmzettel, die sie abgeben und die den Namen ihrer Wahl enthalten. Die Beeinflussung der Wähler bis zu dem Augenblick, in dem sie sich auf den Namen ihrer Wahl endgültig festlegen, ihn niederschreiben oder bezeichnen, mit so ziemlich allen Mitteln ist erlaubt. Der gegnerische Kandidat wird verhöhnt und dem allgemeinen Haß auf jede Weise preisgegeben. Der Wähler kann ich in vielen Wahlschlachten herumtummeln; ihre wechselnden Schicksale haben für ihn, wenn er politisch orientiert ist, den größten Reiz. Aber der Moment, in dem er dann wirklich wählt, ist beinahe heilig; heilig sind die versiegelten Urnen, die die Wahlzettel enthalten; heilig der Vorgang des Zählens. Das Feierliche in all diesen Verrichtungen entstammt dem Verzicht auf den Tod als Instrument der Entscheidung. Mit jedem einzelnen Zettel wird der Tod gleichsam weggelegt. Aber was er bewirkt hätte, die Stärke des Gegners, wird in einer Zahl gewissenhaft verzeichnet. Wer mit diesen Zahlen spielt, wer sie verwischt, wer sie fälscht, läßt den Tod wieder ein und ahnt es nicht. Begeisterte Kriegsliebhaber, die sich über Stimmzettel gern lustig machen, geben damit nur ihre eigenen blutigen Absichten zu. Wahlzettel wie Verträge sind für sie ein bloßer Fetzen Papier. Daß sie nicht in Blut getaucht sind, erscheint ihnen verächtlich, ihnen gelten nur Entscheidungen durch Blut.“
Elias Canetti: Masse und Macht. Frankfurt am Main und Wien (Büchergilde Gutenberg) 1978 (Erstveröffentlichung: 1960). S. 217/218
Weitere Artikel
Elias Canetti: „Innerhalb des Parlaments darf es keine Toten geben“
Donald Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania beinahe ermordet. In seiner wirkmächtigen Schrift Masse und Macht hat Elias Canetti dargelegt, inwiefern das Zwei-Parteien-System die psychologische Struktur des Bürgerkriegs noch in sich trägt – und wo die Gewalt im politischen Kampf ihre Grenze findet.

Abstand halten!
In seinem Hauptwerk „Masse und Macht“ beschreibt Elias Canetti die menschliche „Berührungsfurcht“ — und lässt die Folgen der Corona-Krise in einem neuen Licht erscheinen. Ein Denkanstoß von Svenja Flaßpöhler.

Berührungsfurcht
Abstandhalten zu anderen Menschen ist keine Zumutung. Sondern, so schrieb Elias Canetti in seinem Hauptwerk „Masse und Macht“, ein zutiefst menschliches Bedürfnis.
Canetti und die Macht
Wenn wir heute über Macht reden, geht es oft darum, wie uns Sprache, Normen und Strukturen beeinflussen. Elias Canetti vertrat hingegen ein sehr viel körperlicheres Verständnis: Bei der Machtausübung geht es nicht um Diskurse, sondern ums Belauern, Ergreifen, Festhalten und Verschlingen. Dem gewaltsamen Zugriff entkommt nur, wer sich raffinierter Verwandlungskünste bedient.

Brauchen wir Moskitomagneten?
In seiner „Komödie der Eitelkeit“ hat Elias Canetti 1933 spekuliert, wie eine Welt aussähe, in der es keine Spiegel gibt. Auf Erlass der Regierung werden alle Fotografien verbrannt, alle Spiegel verboten und vernichtet, niemand weiß mehr um sein Aussehen und kann etwa einen roten Fleck am Hals begutachten.
Elite, das heißt zu Deutsch: „Auslese“
Zur Elite zählen nur die Besten. Die, die über sich selbst hinausgehen, ihre einzigartige Persönlichkeit durch unnachgiebige Anstrengung entwickeln und die Massen vor populistischer Verführung schützen. So zumindest meinte der spanische Philosoph José Ortega y Gasset (1883–1955) nur wenige Jahre vor der Machtübernahme Adolf Hitlers. In seinem 1929 erschienenen Hauptwerk „Der Aufstand der Massen“ entwarf der Denker das Ideal einer führungsstarken Elite, die ihren Ursprung nicht in einer höheren Herkunft findet, sondern sich allein durch Leistung hervorbringt und die Fähigkeit besitzt, die Gefahren der kommunikationsbedingten „Vermassung“ zu bannen. Ortega y Gasset, so viel ist klar, glaubte nicht an die Masse. Glaubte nicht an die revolutionäre Kraft des Proletariats – und wusste dabei die philosophische Tradition von Platon bis Nietzsche klar hinter sich. Woran er allein glaubte, war eine exzellente Minderheit, die den Massenmenschen in seiner Durchschnittlichkeit, seiner Intoleranz, seinem Opportunismus, seiner inneren Schwäche klug zu führen versteht.
Maschinen ohne Eigenschaften
Führt KI zu Massenarbeitslosigkeit und Überwachung oder in eine Welt ohne Arbeitszwang und Armut? Beide Ansichten sind zu simpel. Bereits Marx betonte, dass die Folgen von Technik davon abhängen, in welcher Gesellschaft sie zum Einsatz kommt.
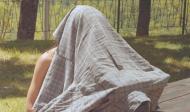
Machen Krisen uns stärker?
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, formuliert Friedrich Nietzsche. Aber woran entscheidet sich, ob wir an Schicksalsschlägen scheitern – oder reifen? Was unterscheidet gesunde Widerständigkeit von Verdrängung und Verhärtung? Machen Krisen kreativer? Ermöglichen allein sie wahre Selbstfindung? Oder wären solche Thesen bereits Teil einer Ökonomisierung des Daseins, die noch in den dunkelsten Stunden unserer Existenz nach Potenzialen der Selbstoptimierung fahndet?
Wolfram Eilenberger legt mit Nietzsche frei, wie man existenzielle Krisen nicht nur überleben, sondern für sich nutzen kann. Ariadne von Schirach singt dagegen ein Loblied auf den Menschen als ewiges Mangelwesen, und im Dialog mit dem Kulturtheoretiker Thomas Macho sucht Roger Willemsen nach dem Gleichgewicht zwischen beschädigter Existenz und Liebe zur Welt.