Wird die Annahme des freien Willens durch die Wissenschaft widerlegt?
Was wäre, wenn die Wissenschaft Antworten auf quälende philosophische Fragen liefern könnte? Der berühmte amerikanische Neurobiologe Robert Sapolsky behauptet in seinem Buch Determined, dass es keinen freien Willen gibt. Albert Moukheiber, selbst Neurowissenschaftler und Psychologe sowie Autor von Fake Brain, zweifelt. Ein Dialog.
Albert Moukheiber: Ich verfolge die Veröffentlichungen von Robert Sapolsky schon seit langem. Wie Oliver Sacks, der Autor von Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte (1985), halte ich ihn für einen der besten Wissenschaftsautoren unserer Zeit – zumal er mich auch in Bezug auf meine Tätigkeit als klinischer Psychologe interessiert. Sein aktuelles Buch Determined scheint mir in zwei Teile gegliedert zu sein: Der erste Teil, zu dem ich einige Vorbehalte habe, widmet sich der Wissenschaft vom freien Willen, während der zweite Teil, der ebenso interessant ist, eine entschieden politische und soziale Position vertritt, in dem Schlussfolgerungen aus dem ersten Teil gezogen werden. Meine Vorbehalte beziehen sich auf folgenden Punkt: Wenn man von „freiem Willen” spricht, muss man genau definieren, was man darunter versteht. Mir scheint, dass Sie ihn als Äquivalent zum „ersten Beweger” von Aristoteles verstehen, einem absoluten Anfang, der den ersten Impuls für eine Bewegung gibt. Aber man muss die Messlatte nicht so hochlegen, denn wenn man so vorgeht, kann man anschließend leicht behaupten, dass nichts solche Bedingungen erfüllt... Würde man die Messlatte hingegen niedriger ansetzen, wäre es zweifellos möglich, so etwas wie einen freien Willen zuzulassen.
Robert Sapolsky: Auf empirischer Ebene verlange ich, dass man mir ein einziges Verhalten zeigt, das völlig unabhängig ist von jeglichem Einfluss durch Genetik, Hormone, sozioökonomische Bedingungen, Umwelt, persönliche Geschichte, Frühstücksinhalt, das Paar Socken, das man trägt, usw. Das ist nicht nur eine Frage der Neurowissenschaften, denn man muss auch die Verknüpfungen zwischen all diesen Daten berücksichtigen. Die meisten Philosophen – aber auch Juristen – sind jedoch das, was ich als „Kompatibilisten” bezeichne, d. h. sie leugnen zwar nicht die Existenz dieser Determinierungen, behaupten aber dennoch, dass es einen freien Willen gibt. Daniel Dennett beispielsweise hält am Prinzip der Wahlmöglichkeit fest. Aber wie könnte eine Wahl existieren, wenn nicht durch Zauberei?
A. M.: Als ich Sie las, dachte ich an den Dämon von Laplace, dieses Gedankenexperiment des französischen Wissenschaftlers Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), der sich einen Geist vorstellte, der alle Positionen und Bewegungen aller Atome im Universum kennen und vorhersagen kann. Nun wissen wir aber, dass die Chaostheorien uns daran hindern, diese Hypothese der vollständigen Vorhersagbarkeit zu bestätigen. Und es ist möglich, den freien Willen anders zu definieren: In der Psychologie ist der freie Wille mit der Metakognition vereinbar, also dem Bewusstsein, das man über seine eigenen mentalen Prozesse hat. Es geht nicht darum zu behaupten, dass der freie Wille aus dem Nichts entsteht, sondern dass es sich vielmehr um Feedback-Schleifen handelt, d. h. um Rückkopplungsmechanismen, die eine Form der metakognitiven Überlegung und letztendlich des Willens ermöglichen.
R. S.: Hier ist man versucht, einen freien Willen zu erkennen. Das ist immer dort der Fall, wo wir nicht oder noch nicht über Instrumente mit einer ausreichend hohen Auflösung verfügen, um eine Erklärung zu finden. Das erinnert mich an die Geschichte eines Mannes, der an einem Tumor in der Amygdala litt und von Kinderpornografie besessen war. Er sah sich täglich mehrere Stunden lang, manchmal sogar ganze Nächte lang, solche Bilder an, bevor er verhaftet wurde. Er wurde angeklagt, und der Richter, der ihn zu einer Gefängnisstrafe verurteilen wollte, war der Ansicht, dass er sich selbst kontrollieren könne, da er laut Polizeiberichten während seiner Arbeitszeit nichts dergleichen getan habe. Seine Argumentation scheint logisch, aber in Wirklichkeit macht sie keinen Sinn! Es gibt Menschen mit Demenz, deren Demenz im Laufe des Tages zunimmt, weil ihr Gehirn müde ist oder ihr Blutzuckerspiegel sinkt. Dies wird als Sonnenuntergangseffekt bezeichnet, der auf eine verschobene biologische Variable zurückzuführen ist. Und weil der Richter sich dessen nicht bewusst ist oder weil noch niemand weiß, wie dieser Effekt funktioniert, ist die Versuchung groß, diese Lücke in der Erklärung mit dem Begriff der Freiheit zu füllen...
A. M.: Wenn ich für einen Moment den Teufelsadvokat spielen sollte, könnte ich entgegnen, dass die Versuchung groß ist, zu behaupten, dass diese Lücke in der Erklärung niemals durch irgendeine Form von Aktivität oder Rekursivität gefüllt werden kann. Auch hier stimme ich Ihnen zu, dass der Begriff „freier Wille” mit all seinen Implikationen und Konnotationen etwas albern erscheint. Es ist offensichtlich, dass es kein unabhängiges Neuron gibt, das in der Luft schwebt und sagt: „Oh, ich werde mich jetzt entzünden!” Sie predigen einem Überzeugten. Wenn Sie jedoch die Wissenschaft der Komplexität und Emergenz ansprechen, muss man zugeben, dass wir nicht immer wissen, wie wir von einer Erklärungsebene zur nächsten gelangen, wie wir von Neuronen zu Netzwerken, von Netzwerken zur nächsten Ebene usw. gelangen. Und vielleicht gibt es bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Emergenz metakognitiver Kontrolle. Vielleicht gibt es einen Handlungsspielraum, der aktiviert und erweitert werden kann.
R. S.: Das wissen wir nicht, aber wir können Hinweise darauf finden. Nehmen Sie einen Menschen und einen Schimpansen: Beide sind in der Lage, eine Belohnung aufzuschieben und langfristig zu planen, aber ein Mensch kann sie so weit aufschieben, dass er Dinge tun kann, von denen er glaubt, dass sie ihm nach seinem Tod den Eintritt ins Paradies ermöglichen. Ein Schimpanse kann das nicht. Ein Schimpanse kann 30 Minuten im Voraus planen, aber nicht sein ganzes Leben, genauso wenig wie er sich Gedanken darüber machen kann, ob seine Enkelkinder einen bewohnbaren Planeten vorfinden werden oder nicht. Aber gibt es da etwas grundlegend anderes, etwas Neues, ja sogar Magisches? Nein, denn im ventralen tegmentalen Areal befindet sich der Nucleus accumbens, und dort gibt es mehr GABA-Neurotransmitter mit einer feineren Rückkopplungskontrolle im menschlichen System als im Gehirn eines Schimpansen. So kann man von „Ich schiebe die Belohnung auf und nehme diese Banane nicht, weil ich bestraft werde, wenn ich es tue” zu „Ich muss hart arbeiten, um in den Himmel zu kommen” gelangen: Es gibt eine Art materielle Grundlage, die dies ermöglicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die eine neue Diät beginnen wollen. Das ist eine metakognitive Aussage. Aber einer wird es tun, während der andere schnell abgelenkt wird und aufgibt. Das liegt nicht daran, dass sie aus philosophischer Sicht einen unterschiedlichen Willen haben, sondern daran, dass sie biologisch gesehen unterschiedliche Gehirne haben, um auf Metakognitionen einzuwirken.
A. M.: Ich denke auch, dass der wesentliche Teil dieses Prozesses dem Willen entzogen ist. Als Psychologe begegne ich vielen Patienten, die mir sagen: „Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich kann nichts dagegen tun.“ Und doch kommen sie aufgrund dieses autonomen Bewusstseins in die Therapie und fragen mich: „Können Sie mir helfen?“ Und damit beginnt etwas. Meine Frage lautet: Glauben Sie, dass diese Eigenschaft des Selbstbewusstseins, die Tatsache, dass wir wissen, dass wir bewusst sind, keinen Einfluss auf die „Suppe“ an Faktoren hat, die bestimmt, wer wir sind? Ich kann doch günstige Bedingungen für mein Handeln schaffen. Ich kann zum Beispiel einen Therapeuten aufsuchen oder mir leicht erreichbare Ziele setzen, um dazu beizutragen, erfolgreich zu sein. Mit meinen Studenten vergleiche ich Ihr Buch mit dem Ihres Kollegen, dem Neurowissenschaftler Kevin Mitchell, Free Agents: How Evolution Gave Us Free Will, um zu zeigen, dass wir mit dem gleichen Ausgangsmaterial manchmal zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen können.
R. S.: Aber wenn Sie einen Patienten haben, der genau weiß, was er tun muss, um sein Leben zu verbessern, und es dennoch nicht tut, liegt das dann daran, dass er eine verdorbene Seele hat? Weil Gott ihn hasst? Weil ihm der Wille fehlt? Weil er ein schlechter Mensch ist? Nein, Sie zeigen ihm, wo er ansetzen kann und was am effektivsten ist. Aber das funktioniert nicht immer, weil sich die Faktoren je nach den Umständen, dem Kontext, der Tageszeit, der Verfassung oder der Müdigkeit ändern. Der eine tut es, der andere nicht, aber ist der zweite deshalb schuld? Ihre Aufgabe ist es vielmehr, zu verstehen, warum diese Person ein Gehirn hat, das für diese Art der Selbstbeherrschung weniger effizient ist. Und die Antwort wird etwas sein, worüber sie keine Kontrolle hat.
A. M.: Das führt uns zu den Konsequenzen Ihrer These. Sie haben den Fall eines Menschen erwähnt, der exzessiv Kinderpornografie konsumiert. In den Vereinigten Staaten, wo Sie leben, gibt es Überlegungen zum „Neurorecht” (neurolaw), also dazu, wie die Fortschritte der Neurowissenschaften in Gesetze und Rechtsvorschriften einfließen können. Aber wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, ist dies ein Forschungsgebiet, das nutzlos ist, da jeder Mensch determiniert und niemand wirklich verantwortlich ist?
R. S.: In der Tat ist „Neurorecht” für das Verhalten von Kriminellen nicht relevant. Letztendlich sind Schuld und Bestrafung weder intellektuell noch moralisch zulässig, auch wenn sie sich als gute Mittel erweisen können, um Menschen von Handlungen abzuhalten – ebenso wenig wie Lob oder Belohnung, die beispielsweise Mittel sind, um Menschen zur Arbeit zu motivieren. Um ganz offen zu sein: Ich bin zutiefst gegen Meritokratie.
A. M.: Ich persönlich halte die Meritokratie für Gift, das den Verstand aller verdunkelt hat und eine der größten Ursachen für Ungerechtigkeit in der heutigen Welt ist. Studien haben gezeigt, wie sehr der soziale Determinismus eine Rolle spielt und dass Erfolg oder Misserfolg keine Frage des Willens (… oder des freien Willens!) sind. In Frankreich gibt es übrigens viele, die die Meritokratie kritisieren. Aber diese Kritik kommt hauptsächlich aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, sodass einige, die der in Frankreich nach wie vor starken positivistischen Tradition angehören, dies für nicht sehr seriös und unwissenschaftlich halten. Ich bin wirklich froh, dass die Kritik dank Ihnen eine neurobiologische Grundlage erhält. Aber das ist umso erstaunlicher von Ihnen, da Sie in den Vereinigten Staaten leben, einem Land, das gewissermaßen auf dem Mythos des amerikanischen Traums und der Meritokratie aufgebaut ist. Wie würden Sie Ihre Gesellschaft weniger meritokratisch machen, als sie heute ist? Welche Instrumente könnten Sie einsetzen, um all dies zu verändern?
R. S.: Zunächst einmal müsste man fünf oder sechs Jahrhunderte lang den Atem anhalten, denn der Prozess wird sehr langsam verlaufen. Die meisten Menschen glauben heute nicht mehr, dass Staatschefs von Gott auserwählt wurden, um Sonnenkönige zu sein (auch wenn Trump offenbar der Meinung ist, dass er einem Attentatsversuch durch göttliche Fügung entkommen ist). Wir machen große Fortschritte. Wir könnten damit beginnen uns vor Augen zu halten, dass man als Lehrer, der Kinder für gute Ergebnisse in einer Rechtschreibprüfung lobt, nicht vergessen sollte, zu dem Kind mit Legasthenie, das nicht so gut abgeschnitten hat, etwas anderes zu sagen. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass das früher nicht so war: Wenn das Kind, das in der Schule neben mir saß, nicht lesen lernte, wusste ich warum, und der Lehrer wusste warum, und die Eltern wussten warum, nämlich dass das Kind nicht sehr intelligent war, faul und unmotiviert.
A. M.: Natürlich werden wir die Meritokratie nicht sofort abschaffen, aber die Frage ist: Wo sollen wir anfangen? Man denkt zuerst an Kriminelle, aber wenn man mit Kriminellen spricht, wird man sie kaum davon überzeugen können, dass sie für ihre Taten nicht verantwortlich sind. Weniger denkt man an diejenigen, die sozial erfolgreich sind: Wie kann man sie davon überzeugen, dass sie ihre gute Situation, ihr Gehalt und ihren Lebensstil nicht unbedingt verdienen?
R. S.: Ich gebe zu, dass ich bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht sehr mutig war, und das Wort „Meritokratie” kommt im ganzen Buch nur einmal vor. Die Gesellschaft muss vor gefährlichen Menschen geschützt werden, und zwar nicht nur, um sie von Verbrechen und Vergehen abzuhalten. Wie kann man Menschen motivieren, hart zu arbeiten, sich weiterzubilden und herausragende Leistungen zu erbringen, ohne dass bei ihnen ein moralisches Anspruchsdenken entsteht? Vielleicht liegt die Lösung in einem Bottom-up-Ansatz. Nehmen wir zum Beispiel die jungen Menschen, die sich dieses Jahr in Stanford oder Harvard beworben haben und angenommen wurden, und diejenigen, die abgelehnt wurden. Fragen wir diejenigen, die angenommen wurden: „Wie viele von Ihnen haben als Kind Musikunterricht genommen? Wie viele von Ihnen hatten Eltern, die mit Ihnen gespielt haben? Wie viele von Ihnen haben Nachhilfeunterricht erhalten?“ usw. Selbst wenn – und das wird der Fall sein – die Besten zugelassen werden, wird man feststellen, dass nicht alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten hatten. Daher rührt die Wut der Benachteiligten, die Donald Trump an die Macht gebracht haben. Eine andere Interpretation lautet jedoch: Es gibt wirklich ein Problem der Ungleichheit, wenn einige Schulbezirke zehnmal mehr Geld pro Schüler erhalten als andere. Und wenn man diese Ungleichheiten nicht beseitigen kann, müssen diejenigen, die erfolgreich waren, zumindest versuchen, dieses Gefühl der Überlegenheit abzulegen. Das ist natürlich sehr schwierig. Denjenigen, die nicht zugelassen wurden, zu sagen, dass sie es nicht geschafft haben, weil sie diese Vorteile nicht hatten, bedeutet, Trump-Anhänger zu schaffen; aber man kann denen, die zugelassen wurden, zeigen, dass sie es nicht verdient haben. Das ist eine kognitive Dissonanz.
A. M.: Diese Zugelassenen werden antworten, dass sie es ihren Eltern oder Großeltern zu verdanken haben, die es verdient haben. Es ist immer schwieriger, jemanden, der etwas hat, davon zu überzeugen, dass er es nicht verdient, als jemanden, der nichts hat, davon zu überzeugen, dass es nicht seine Schuld ist. Die Asymmetrie ist enorm. Und man kann immer den Einzelfall anführen, dass jemand erfolgreich war, obwohl er nichts hatte.
R. S.: Das ist eine viel heiklere Frage als die der Kriminalität, und ich bin überzeugt, dass man sich auf den Mythos des freien Willens beruft, weil er perfekt zur Meritokratie passt. Ich denke, wir brauchen auch eine gewisse Kraft, um zu glauben, dass wir etwas ändern können. Aber es geht eher um Geschichten. Und die Aufgabe eines Psychologen besteht darin, sehr vorsichtig zu sein, wie man seinen Patienten Geschichten erzählt, nicht wahr? Und die Aufgabe eines Psychologen besteht darin, abzuwägen, wie man seinen Patienten Geschichten erzählt, nicht wahr?
A. M.: Das hängt ganz davon ab, welche Geschichten wir erzählen. Es ist nicht trivial, dass wir Geschichtenerzähler sind. Geschichten sind äußerst performativ, und letztendlich sind wir eine Spezies, die darum kämpft, welche Geschichte sich durchsetzt – sei es die vom Menschen im Himmel, die vom Orakel oder die vom Geld und der Meritokratie. •
Weitere Artikel
5 Irrtümer über unser Gehirn aufgeklärt
Wir haben kein „Reptiliengehirn”, viele Persönlichkeitstests sind unzuverlässig und Emotionen werden nicht von Hormonen „gesteuert”. Der Neurowissenschaftler Albert Moukheiber widerlegt diese und zwei weiteren Mythen über unser Gehirn.

Klarheit durch Methode
René Descartes begründet eine neue Erkenntnistheorie und eine neue Metaphysik: der Körper als Maschine, die Seele als Refugium des freien Willens, der Mensch als mysteriöse Einheit von Körper und Seele. Ein Glossar seiner wichtigsten Grundbegriffe.

Mein Wille, das unbekannte Wesen
Unser Wille, was soll er nicht alles sein: innerer Kompass und ewiger Antrieb, Garant des Erfolgs und Quelle der Lust. Doch gerade in entscheidenden Situationen erweist er sich oft als schwach und desorientiert. Woher weiß ich also, was ich wirklich will? Durch rationale Abwägung und Kontrolle meiner Begierden? Oder offenbart sich mein wahrer Wille gerade im dunklen, irrationalen Drängen tief im Innern? Womöglich gäbe es sogar eine dritte Option: Was, wenn die wahre Freiheit des Menschen gerade in der Überwindung seines Willens läge? Entscheiden Sie selbst
Wie weit geht die Selbstwirksamkeit?
Die Initiativen NO-COVID und #ZeroCovid wollen die Neuinfektionen auf null bringen. Obwohl sie dafür verschiedene Instrumente vorschlagen, setzen beide auf jene Selbstwirksamkeitserwartung, die der Psychologe Albert Bandura bereits in den 1970er Jahren untersuchte. Jedoch birgt diese auch eine Gefahr.

Judith Butler und die Gender-Frage
Nichts scheint natürlicher als die Aufteilung der Menschen in zwei Geschlechter. Es gibt Männer und es gibt Frauen, wie sich, so die gängige Auffassung, an biologischen Merkmalen, aber auch an geschlechtsspezifischen Eigenschaften unschwer erkennen lässt. Diese vermeintliche Gewissheit wird durch Judith Butlers poststrukturalistische Geschlechtertheorie fundamental erschüttert. Nicht nur das soziale Geschlecht (gender), sondern auch das biologische Geschlecht (sex) ist für Butler ein Effekt von Machtdiskursen. Die Fortpf lanzungsorgane zur „natürlichen“ Grundlage der Geschlechterdifferenz zu erklären, sei immer schon Teil der „heterosexuellen Matrix“, so die amerikanische Philosophin in ihrem grundlegenden Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“, das in den USA vor 25 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Seine visionäre Kraft scheint sich gerade heute zu bewahrheiten. So hat der Bundesrat kürzlich einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine vollständige rechtliche Gleichstellung verheirateter homosexueller Paare vorsieht. Eine Entscheidung des Bundestags wird mit Spannung erwartet. Welche Rolle also wird die Biologie zukünftig noch spielen? Oder hat, wer so fragt, die Pointe Butlers schon missverstanden?
Camille Froidevaux-Metteries Essay hilft, Judith Butlers schwer zugängliches Werk zu verstehen. In ihm schlägt Butler nichts Geringeres vor als eine neue Weise, das Subjekt zu denken. Im Vorwort zum Beiheft beleuchtet Jeanne Burgart Goutal die Missverständnisse, die Butlers berühmte Abhandlung „Das Unbehagen der Geschlechter“ hervorgerufen hat.
Mazviita Chirimuuta: „Neurowissenschaftliche Modelle müssen mit mehr Vorsicht interpretiert werden“
Was, wenn unsere neurowissenschaftlichen Modelle des Gehirns zu vereinfachend sind, um die Realität abzubilden? Zu dieser Lektion der Demut lädt das Buch The Brain Abstracted ein, das in Großbritannien den Preis des Royal Institute of Philosophy gewann. Ein Interview mit dessen Autorin Mazviita Chirimuuta.
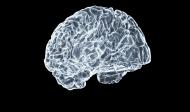
Robert Pfaller und Paula-Irene Villa im Dialog: Wo liegt die Grenze des Sagbaren?
Kaum eine Frage wird derzeit kontroverser diskutiert: Ist rücksichtsvolles Sprechen Ausdruck des sozialen Fortschritts? Oder blockieren Sensibilitäten die demokratische Debattenkultur? Der Philosoph Robert Pfaller und die Soziologin Paula-Irene Villa über Verletzlichkeit, Political Correctness und die Macht der Worte.

Rechts vom System
Über Jahrzehnte lag das revolutionäre Potenzial links. Mittlerweile ist es eher im Lager der Rechtspopulisten zu vermuten. Der Sturz des Systems wird hier im Namen einer „Konservativen Revolution“ und eines „Willens zur Selbstbehauptung“ gefordert. Aus welchen geistigen Quellen schöpfen die Vordenker der Neuen Rechten? Und was treibt sie wirklich an? Eine Deutschlandreise der anderen Art.