Thoreau und der amerikanische Traum
Henry David Thoreau, dessen Todestag sich heute zum 160. Mal jährt, ist der amerikanische Philosoph par excellence. Sein Denken sucht den Widerstreit mit seinem Land. Dieter Thomä legt frei, inwieweit Thoreaus patriotische Kampfschrift Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat jedem wahren Amerikaner aus der Seele sprechen muss.
Henry David Thoreau ist vor allem durch drei Texte weltberühmt geworden: durch seine Schrift Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, durch Walden, seinen Bericht über sein Leben in einer kleinen Hütte in einem Waldstück in Massachusetts, und durch seinen posthum veröffentlichten Essay Walking, deutsch: Vom Spazieren. Wollte man diese sehr verschiedenen Texte auf eine Formel konzentrieren, so könnte sie lauten: Folge deinem Begehren und beschränke deine Bedürfnisse.
In ihrer abstrakten Allgemeinheit könnte diese Formel allerdings leicht dazu führen, das Spezifische an Thoreaus Vorhaben zu übersehen. Thoreau ist nämlich sehr bewusst und emphatisch Amerikaner und arbeitet an etwas, das er mitbegründen wird: an einem spezifisch amerikanischen Schreiben, einer spezifisch amerikanischen Sensibilität. Sie bildet die Grundlage für eine amerikanische Kunst und ein amerikanisches Denken, das Thoreau in seiner Zeit neben anderen Autoren wie Ralph Waldo Emerson, James Fenimore Cooper oder Walt Whitman erschaffen hat.
Thoreaus existenzielles Begehren ist das Schreiben. Dieses Schreiben soll so neu sein wie das unabhängige, sich von dem alten Europa emanzipierende Amerika. So neu, dass es buchstäblich zu einem neuen Sehen und Hören führt. Zu einer Weise, auf der Welt zu sein. Wie weit Thoreau dabei gekommen ist, kann man unter anderem daran ermessen, dass sich spätere Freiheitskämpfer wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela auf seine Schrift vom zivilen Ungehorsam gegen den Staat berufen haben. Wobei die Wirkkraft dieses Textes bis heute weniger in seiner konkreten Argumentation liegt als vielmehr in dem Schwung und Enthusiasmus für den Freiheitskampf, den der Text weiterzugeben in der Lage ist.
Der Traum von der eigenen Hütte
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Gottlob Frege und die Sprache
Gottlob Frege, dessen Todestag sich am 28. Juli 2025 zum 100. Mal jährte, gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie: jener Strömung, die sich von metaphysischer Spekulation abwandte und nach einer präzisen, an die Mathematik erinnernden Sprache suchte. Was hat uns Frege über Funktionsweise und Fallstricke der Sprache zu sagen?
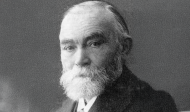
Aristoteles und die Seele
In seiner wirkmächtigen Abhandlung Über die Seele behauptet Aristoteles: Die Seele ist kein Körper, aber sie existiert auch nicht ohne ihn. Ja, was denn nun, fragen Sie sich? Wir helfen weiter!

Dieter Thomä: "Keine Demokratie ohne Störenfriede!"
Was tun, wenn man sich fremd in der eigenen Gesellschaft fühlt? Gar eine radikal andere Welt will? Fragen, die im Zentrum des Denkens von Dieter Thomä stehen. Ein Gespräch über kindischen Lebenshunger, gestörte Männer und die tödliche Sehnsucht nach totaler Ordnung.
Dieter Thomä: „Wer einen guten, wohltuenden Frieden stört, ist einfach nur ein Querulant“
Nach Jahren der Provokation verließ Tübingens Oberbürgermeister letzte Woche die Grünen. Was der Schritt über die Zukunft der Partei aussagt und was Boris Palmer zum produktiven Störenfried fehlt, erläutert der Philosoph Dieter Thomä im Interview.

Dieter Thomä: „Die USA laufen Gefahr, sich in zwei gänzlich parallele Gesellschaften zu entwickeln“
Viele der Kriminellen, die am 6. Januar das Kapitol stürmten, inszenieren sich als Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum sie genau das Gegenteil sind, die Demokratie aber dennoch „radikale Störenfriede“ braucht.

Wohin soll ich reisen?
Ob vor der Haustür oder in fernen Ländern: Der Mensch braucht Urlaub. Aber wo sollte man die Ferien verbringen? Philosophische Reisetipps von Petrarca, Henry D. Thoreau und Hans Blumenberg.

„Wir haben die Pflicht, Sinn zu stiften“
Reinhold Messner ist einer der letzten großen Abenteurer der Gegenwart. Mit seiner Ehefrau Diane hat er ein Buch über die sinngebende Funktion des Verzichts geschrieben. Ein Gespräch über gelingendes Leben und die Frage, weshalb die menschliche Natur ohne Wildnis undenkbar ist.

Richard David Precht: „Man tut den Menschen keinen Gefallen, wenn man ihnen die Pflicht nimmt“
Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird durch die Corona-Pandemie zusätzlich befeuert. Viele Jobs werden zukünftig überflüssig, Künstliche Intelligenz ersetzt den Menschen. Im Interview spricht der Philosoph Richard David Precht über die Ambivalenz dieser Entwicklung - und die große Herausforderung, Sinn auch jenseits der Arbeit zu finden. Sein Buch „Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens“ (2020) ist bei Goldmann erschienen.
