Auf der Suche nach dem sechsten Sinn
Gibt es neben den fünf bekannten Sinnen noch einen weiteren? Diese zunächst naturwissenschaftlich anmutende Frage beschäftigte auch Denker wie Aristoteles, Rousseau, Buffon und Husserl. Hier stellen wir ihre Antworten vor.
Sehen, Schmecken, Tasten, Riechen und Hören gelten gemeinhin als die fünf Sinne, mittels derer wir Menschen auf unsere Umgebung zugreifen können. Jedoch mehren sich wissenschaftliche Hinweise dafür, dass es noch weitere Sinne gibt: die Propriozeption (die Wahrnehmung der Stellung unserer eigenen Gliedmaßen), die Thermozeption (das Temperaturempfinden), die Nozizeption (das Schmerzempfinden) und den Gleichgewichtssinn.
Lange bevor die Naturwissenschaft weiteren Quellen der Wahrnehmung erforschte, machten sich Philosophen bereits auf die Suche nach einem sechsten Sinn und stellten ihre eigenen Theorien dazu auf. Hier ein Überblick.
Aristoteles / Ein einender Gemeinsinn
In seiner berühmten Abhandlung Über die Seele unternimmt Aristoteles den Versuch, den Seh-, Geschmacks-, Tast-, Geruchs- und Gehörsinn genau zu beschreiben. Obwohl der griechische Philosoph behauptet, dass uns nur diese fünf Sinne mit der Außenwelt in Verbindung bringen, stellt er die These auf, dass es noch einen sechsten Sinn geben muss: „Da wir aber das Weiße und das Süße und jeden wahrnehmbaren Gegenstand von jedem (anderen) unterscheiden, nehmen wir auch mit irgendetwas wahr, dass sie sich unterscheiden. Offenbar notwendig durch Wahrnehmung; es sind ja wahrnehmbare Gegenstände.“
Diesen Sinn nennt Aristoteles „Gemeinsinn“. Gemein bedeutet hier nicht, dass er alle Menschen untereinander in Verbindung bringt, sondern dass er auf Grundlage der anderen Sinne arbeitet. Während die fünf bekannten Sinne nach außen gerichtet und dafür immer mit einem bestimmten Organ verbunden sind, ist der Gemeinsinn eine Fähigkeit des Inneren und spielt für den griechischen Philosophen eine entscheidende Rolle: Dieser sechste Sinn ist dafür verantwortlich, die Flut an Informationen, die durch die fünf Wahrnehmungssinne zu uns durchdringen, zu ordnen und aufeinander abzustimmen. Nur durch ihn sind wir dazu fähig, die verschiedenen Eindrücke voneinander zu unterscheiden. Wie könnten wir sonst wissen, dass süß süß und weiß weiß ist? Wir würden unsere Wahrnehmungen miteinander vermischen und die Welt erschiene uns als ein chaotisches Durcheinander von Empfindungen. Der Gemeinsinn ist so also der einende Sinn, der es uns ermöglicht, sämtliche sinnliche Eindrücke zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufassen.
Rousseau / Der sechste Sinn als Vernunft
In „Émile oder Über die Erziehung“ greift Jean-Jacques Rousseau die Idee von Aristoteles auf und beschreibt die Existenz „einer Art sechsten Sinnes, der gewöhnlich der Gemeinsinn genannt wird, weniger wohl deshalb, weil er allen Menschen gemeinsam ist, als vielmehr aus dem Grunde, weil er aus dem richtig geordneten Gebrauch der übrigen Sinne entsteht [...]“. Doch während Aristoteles seinen Gemeinsinn trotz seiner ordnenden Funktion der anderen als eine Art Sinn auf der Ebene der Restlichen verortet, geht Rousseau einen Schritt weiter. Der sechste Sinn, so sagt er, „zeigt [sich] nur im Gehirn, und die rein innerlichen Wahrnehmungen desselben werden Vorstellungen oder Ideen genannt.“ In Rousseaus Theorie ist Aristoteles' sechster Sinn für das Gehirn also dasjenige, was das Sehen für das Auge ist. Folglich besteht die Kunst des Gemeinsinns darin, die Empfindungen des Gehirns so miteinander zu verbinden, dass sie Ideen bilden können. Rousseau bezeichnet den sechsten Sinn als „sensitive Vernunft“. Durch immer raffiniertere Assoziationen von Ideen kann sich die „sensitive Vernunft“ zur „intellektuellen Vernunft“ weiterentwickeln.
Buffon / Der sechste Sinn als das Verlangen nach dem anderen
Der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon, Autor einer monumentalen Naturgeschichte, fasste seine Thesen über die Sinneswahrnehmungen poetisch in einer kurzen Parabel zusammen. Er beschreibt einen Menschen, der am Morgen der Schöpfung erwacht und beginnt sich seiner Empfindungen bewusst zu werden. Zunächst schlägt er seine Augen auf und wundert sich über das einfallende Licht. Dann bemerkt er, dass er die Welt auch hören, fühlen und schmecken kann. Die größte Verzückung erfährt Buffons Adam jedoch erst nach dem Erscheinen von Eva: „Ich legte meine Hand an dieses neue Wesen; welch ein Erstaunen! Es war nicht ich; es war mehr als ich, besser als ich: Ich glaubte, dass meine Existenz den Ort wechseln und ganz auf diese zweite Hälfte von mir übergehen würde.“
Man könnte meinen, dass an dieser Stelle die Entwicklung der Sinne an ihr Ende kommt, um dem Verlangen Platz zu machen und Adam somit von der Empfindung zum Gefühl abdriftet. Buffon beschreibt die ihn überkommende Leidenschaft jedoch anders: „Ich hätte diesem anderen mein ganzes Wesen geben wollen; dieser lebendige Wille vollendete mein Dasein; ich fühlte, dass ein sechster Sinn in mir entstand.“ Mit dieser emphatischen Pointe überlässt es Buffon dem Leser, zu erraten, dass der sechste Sinn zweifellos die Liebe ist, dieses sich ins Absolute steigernde Verlangen nach dem gleichartigen Gegenüber.
Husserl / Der sechste Sinn als Bewegung
Blicken wir von vorne auf einen Würfel, so haben wir nur die visuelle Wahrnehmung seiner Vorderseite. Nun bewegen wir uns um den Würfel herum, sodass wir auf seine Rückseite blicken. Woher wissen wir in diesem Versuch, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Würfel handelt, ohne dass wir im Moment die Möglichkeit haben, uns dessen durch unsere visuelle Wahrnehmung zu vergewissern? In seiner Vorlesungsreihe „Sinn und Raum“ aus dem Jahr 1907 fragt der deutsche Philosoph Edmund Husserl nach dem Ursprung unserer Fähigkeit, diesen „kontinuierliche Übergang […] im Nacheinander der Wahrnehmungen“ und somit die „Identität der Gegebenheit“ des Würfels zu erkennen.
Für den Phänomenologen wird die „Identität des Raumes“ durch die Empfindung des Subjekts, das sich in ihm bewegt, ermöglicht. Jedoch, so Husserl, sei der Begriff „Bewegungsempfindung“ für uns „unbrauchbar“, da wir nicht spüren, dass sich die äußeren Dinge bewegen. Wir spüren nur uns selbst und unsere eigene Bewegung um den Würfel herum. Der Philosoph zieht es daher vor, von „kinästhetischer Empfindung“ zu sprechen (von griechisch „kinesis“, „Bewegung“, und „aisthesis“, „Wahrnehmung“, „Empfindung“). Kinästhetik ist demnach die Empfindung der Bewegungen des eigenen Körpers, die uns eine Vorstellung des Raumes ermöglicht. Bei der Frage, ob diese Empfindung unser sechster Sinn ist, ist Husserl jedoch zurückhaltender: „Ob sie eine grundwesentliche neue Grundgattung von Empfindungen ausmachen oder nicht vielmehr mit den Tastempfindungen in eine obere Gattung zusammengehören, das ist eine Doktorfrage.“
Indem er den Begriff der Propriozeption prägte, gab ausgerechnet ein britischer Wissenschaftler, Charles Sherrington, der 1932 den Nobelpreis für Medizin erhielt, dieser philosophischen Intuition einige Jahre später eine naturwissenschaftliche Entsprechung. Propriozeption ist die sensible Wahrnehmung unseres eigenen, sich bewegenden Körpers, seines Volumens und seiner Raumdimensionen. Husserl hatte also genau richtig gelegen: Der sechste Sinn steckt in der Bewegung! •
Weitere Artikel
Edmund Husserl und der Eigenleib
Der Begründer der Phänomenologie, Edmund Husserl, schreibt, unser „Eigenleib“ sei „Zentralglied der dinglichen Umgebungsauffassung“. Was meint er damit?

Leben und Werk im Widerspruch: Jean-Jacques Rousseau
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Jean-Jacques Rousseau, der trotz seiner radikalen Erziehungsideale seine eigenen Kinder ins Waisenhaus gab.
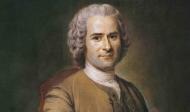
Rousseau gegen Tomaten im Winter
Durch steigende Energiekosten wird der Anbau von Tomaten in beheizten Gewächshäusern für viele Landwirte unrentabel. Schweden kündigte nun sogar an, die nationale Produktion einzustellen. Also keinen Tomaten in diesem Winter? Für Rousseau ist das kein Problem.

Rousseau und der volonté générale
Einzelinteressen lassen sich mit dem Gemeinwesen in Einklang bringen, indem man vom Gesamtwillen das Mehr oder Weniger abzieht, meint Jean-Jacques Rousseau. Sie verstehen nur Bahnhof? Wir helfen weiter.

Kaum zu glauben! - Vier Skeptiker
Skeptiker sind Querdenker. Mit einfallsreichen, bisweilen surreal anmutenden Gedankenexperimenten stellen sie die Grundlagen unseres Weltbildes infrage. Sie erweisen sich damit bis heute als die eigentlichen Motoren der Philosophiegeschichte. Ein Überblick der einflussreichsten Zweifels-Fälle. Und ihrer Entgegnungen.
Aristoteles und die Seele
In seiner wirkmächtigen Abhandlung Über die Seele behauptet Aristoteles: Die Seele ist kein Körper, aber sie existiert auch nicht ohne ihn. Ja, was denn nun, fragen Sie sich? Wir helfen weiter!

Der letzte sowjetische „Idealist"
Der sowjetische Philosoph Ewald Iljenkow war seiner Zeit voraus. Als Einzelkämpfer war er weder von der Partei noch von den im Westen bekannten liberalen Dissidenten anerkannt. Heute entdeckt man ihn neu – als einen der interessantesten Philosophen der Sowjetzeit.

Genieße deine Dauer
Der reine Augenblick ist ein abstrakter Traum. Wir hingegen erleben eine Gegenwart, die immer auch Vergangenheit und Zukunft enthält. Denker von Augustinus bis Husserl waren diesem Phänomen der „Dauer“ auf der Spur. Es lohnt sich, ihren großen Erzählungen über die wahre Natur der Gegenwart zu folgen.