Jan Assmann: „Das Verhüllen des Kopfs hat mit Religion nichts zu tun“
Der EuGH formulierte jüngst Hürden für ein Verbot von Kopftüchern am Arbeitsplatz. Religionswissenschaftler Jan Assmann erklärt, warum solch ein Verbot besser komplett unrechtmäßig sein sollte – und warum die Verhüllung eigentlich nichts mit Religion zu tun hat.
Herr Assmann, jüngst fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Urteil, wonach Arbeitgeber muslimischen Mitarbeiterinnen grundsätzlich das Tragen von Kopftüchern am Arbeitsplatz verbieten dürfen. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?
So wie ich dieses Urteil verstanden habe, hat der EuGH zwar den Arbeitgebern grundsätzlich erlaubt, im Bereich ihrer Betriebe ein Kopftuchverbot auszusprechen, ihnen aber die Beweislast für dessen Berechtigung auferlegt. Der Arbeitgeber muss das Verbot stichhaltig begründen. Das heißt doch, dass die Arbeitnehmerin grundsätzlich berechtigt ist, ihr Kopftuch auch am Arbeitsplatz zu tragen, sofern der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, stichhaltige Gründe dagegen geltend zu machen.
Laut EuGH gehöre es zur unternehmerischen Freiheit, eine „Politik der Neutralität“ zu verfolgen. Gleichwohl müssen Arbeitgeber bei einem Kopftuchverbot nachweisen, dass sie andernfalls einen spürbar wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Halten Sie das für eine nachvollziehbare Hürde?
Es ist jedenfalls eine Hürde. Besser wäre natürlich, das Kopftuchverbot würde grundsätzlich für unrechtmäßig erklärt.
In einem Gutachten des Gerichtshofs heißt es außerdem, dass kleinere religiöse Symbole „die nicht auf den ersten Blick bemerkt werden“ nicht vom Urteil erfasst würden. Was stört uns noch immer an der Sichtbarkeit religiöser Symbole, wo wir doch wissen, dass es in Deutschland eine Vielzahl religiöser Überzeugungen gibt?
Es ist doch gut, dass das Gericht kleinere religiöse Symbole, etwa Halskettchen mit Davidsstern, von dem Urteil ausnimmt. So etwas zu beanstanden, haben die Arbeitgeber schon einmal kein Recht. „Uns“ stört so etwas schon gar nicht, nur Antisemiten und Islamophobe und radikale Atheisten, wogegen ohnehin kein Kraut gewachsen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei der Rechtsprechung nicht vom öffentlichen Raum, der „uns“ angeht, die Rede ist, sondern vom Privatraum der Betriebe, für den diese betriebsinternen Kopftuchverbote gelten. Deren Berechtigung muss jetzt im Einzelfall nachgewiesen werden. Das ist doch ein Fortschritt.
Ein wichtiger Aspekt des grundgesetzlich festgehaltenen Neutralitätsgebot im Hinblick auf den Staat ist die Gleichbehandlung aller Religionen und Weltanschauungen. Warum scheint von Kopftüchern am Arbeitsplatz allerdings eine größere Gefahr auszugehen als von der Tatsache, dass seit dem 1. Juni 2018 in den Eingangsräumen sämtlicher bayerischer Dienstgebäude ein christliches Kreuz hängen muss?
Die Abwehr gegen Kopftücher am Arbeitsplatz finde ich provinziell und unverständlich. Was für eine Gefahr soll von ihnen ausgehen? Das Tragen eines Kopftuchs wird nicht im Koran vorgeschrieben, es ist eine Sache der Tradition, nicht der Religion im strengen Sinne. Nur das Verbot gibt ihm einen status confessionis. Das Verhüllen des Kopfs bei Frauen ist eine antike Sitte, seit alters bezeugt in Mesopotamien, Griechenland und Rom, und hat mit Religion nichts zu tun, sondern eher mit gesellschaftlichem Status, Würde und Zurückhaltung. Zum religiösen Symbol scheint das Kopftuch erst geworden zu sein, nachdem es im Zuge radikaler Modernisierungsbestrebungen in der Türkei und im Iran zeitweise verboten wurde. Im Übrigen bin ich ebenso wie gegen das Kopftuchverbot am Arbeitsplatz gegen das Kreuzgebot in bayrischen Dienstgebäuden.
Ihre Theorie des kulturellen Gedächtnisses geht davon aus, dass das Gedächtnis auch eine Außenseite hat und Bilder, Riten, Bauten etc. sich durch Kommunikation in uns einschreiben und so die Grundlage unserer Erinnerungsfähigkeit bilden. Beschneidet das Urteil dann allerdings nicht das religiös-kulturelle Gedächtnis dieses Landes, indem es eine Vielfalt unsichtbar macht, die tatsächlich besteht?
Offenbar erlaubt es die Rechtsprechung in Europa derzeit nicht, Arbeitgebern grundsätzlich das Verbieten von Kopftüchern am Arbeitsplatz zu verbieten. Möglich ist nur, dieses Verbot zu erschweren, indem nun die Beweislast beim Arbeitgeber liegt. Den Arbeitsgerichten obliegt es, diese Beweislast streng, im Sinne der Arbeitnehmerinnen, auszulegen. Das kulturelle Gedächtnis in Europa scheint mir davon nicht betroffen. •
Jan Assmann ist Ägyptologe, Religionswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und lehrte von 1976 bis zu seiner Emeritierung 2003 als Professor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Zuletzt erschien von ihm „Kult und Kunst – Beethovens Missa Solemnis als Gottesdienst“ (C.H. Beck, 2020).
Weitere Artikel
Jan Assmann: „Es gibt keine wahre Religion“
Ägypten ist die eigentliche Wiege der europäischen Kultur, monotheistische Religionen neigen zur Gewalt, der Holocaust wird die Religion der Zukunft. Der Ägyptologe Jan Assmann gehörte zu den thesenstärksten Kulturtheoretikern unserer Zeit. Nun ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. 2013 führten wir ein Gespräch mit dem Mann, dessen Gedächtnis mehr als 6000 Jahre in die Vergangenheit reicht.

Aleida Assmann: „Wir müssen die Demokratie von unten zusammenhalten“
Mit ihrem neuen Buch Gemeinsinn. Der sechste, soziale Sinn gehen Aleida und Jan Assmann einem wesentlichen Teil des Menschseins nach, der von individualistischen Gesellschaften nahezu vergessen scheint. Im Gespräch erklärt Aleida Assmann, wie solch ein Gemeinsinn aussehen kann – und warum er für unsere Gesellschaft entscheidend ist.

Jan Assmann: „Mythen stellen Wirklichkeit her“
Die griechischen Mythen gehen auf noch ältere Vorbilder zurück und werden auch heute noch neu interpretiert. Im Interview erläutert der Kulturtheoretiker und Ägyptologe Jan Assmann, wie uns diese Erzählungen seit jeher helfen, die Welt zu verstehen.

Aleida Assmann: „Die Geschichte der USA steht auf der Kippe“
Wie der Sturm auf das US-Kapitol in das kollektive Gedächtnis eingehen wird, ist radikal offen, meint die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Ein Gespräch über Geschichtspolitik und das Trauma des 6. Januar.

Kurt Cobain, der Selbstmörder der Gesellschaft
Vor dreißig Jahren nahm sich der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana mit einem Kopfschuss das Leben. Kurt Cobain, der eines der meistverkauften Alben aller Zeiten geschrieben hatte, verkörperte quasi im Alleingang eine Philosophie und eine Musikrichtung, die ebenso prägend wie kurzlebig war: den Grunge. Wer war dieser charismatische Rocker, der die Welt auf seine eigene Art verändert hat?
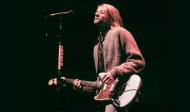
Herzrasen ist auch Kopfsache
Martha Nussbaum präsentiert eine Alternative zu der Idee, dass Emotionen rein animalische, irrationale Energien sind. Gemäß einer neustoischen Lesart stellt sie Emotionen als Urteile in den Mittelpunkt ihrer Moralphilosophie

Unterentwickelte Werte
Der mangelnde Distanzierungswille afrikanischer Länder von Russland wird hierzulande gern mit Kopfschütteln begleitet. Was mehr über uns aussagt als über Afrika, meint Nora Bossong.

Warum es verrückt wäre, sich nicht als Hochstapler zu fühlen
Viele kennen die Angst, unrechtmäßig zu Erfolgen gekommen zu sein – das sogenannte „Hochstapler-Syndrom“. Doch was, wenn die Einschätzung nicht pathologisch, sondern ein Zeichen von Klarsicht ist, weil gesellschaftliche Rollen unausweichlich mit Vortäuschung verbunden sind?
