Katharina Wicht: „Redefreiheit bedeutet auch, sich von inneren Zensuren freizumachen“
Katharina Wicht hat 2022 den Parrhesia Verlag für Philosophie und Belletristik gegründet. Im Interview erzählt sie von ihrer „edition Schatten“, mit der sie den Werken Aufmerksamkeit schenken will, die sonst nicht beachtet werden.
Frau Wicht, Sie haben vor Kurzem den Parrhesia Verlag gegründet. Wie kam es dazu?
Ich habe vorher in einem kleinen Verlag in Kreuzberg gearbeitet, der nicht ganz meine Genres verlegt hat. Da ich dadurch das Verlagswesen aber kennengelernt habe, wollte ich dann meine eigenen Ideen umsetzen.
„Parrhesia“ ist griechisch für Redefreiheit. Eine andere Übersetzung von Parrhesia ist allerdings „über alles sprechen“. Ist das auch Leitlinie des Verlags?
Ich habe mich im Studium viel mit Michel Foucault beschäftigt, der schreibt ja auch einiges über Parrhesia. Mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass das vielleicht ungute Anklänge bei Verschwörungstheoretikern finden könnte. Das kam mir aber damals gar nicht in den Sinn. Ich fand daran immer faszinierend, wie Foucault beschreibt, dass die Redefreiheit nicht immer von außen, sondern auch durch innere Regulatorien gefährdet ist. Redefreiheit bedeutet also auch, sich von inneren Zensuren freizumachen. Ich verlege Philosophie und Belletristik und denke, dass diese beiden Genres gemeinsam haben, dass die Autoren Wahrheiten über sich selbst sprechen. Es sind natürlich Objekte der Welt, die zum Thema werden, aber wenn ein fiktionales Buch gut ist, dann gibt der Autor immer auch Wahrheiten über sich selbst preis. Ich wollte also meine Kriterien für ein gutes Buch, sowohl in der Philosophie als auch in der Belletristik, vereinen.
Sie veröffentlichen unter anderem so genannte Schattenwerke. Was ist das genau?
Angelehnt an die gelben Reclam-Bändchen sollen sie sozusagen der Schatten dieser Reihe sein. Als ich jünger war, war ich großer Fan der gelben Sammlung und habe auch viel gelesen aus verschiedenen Kanons wie „100 Bücher, die du gelesen haben musst“. Im Laufe des Studiums habe ich natürlich einiges gefunden, was nicht in diesen Listen war. Trotzdem haben aber viele Menschen dieses Bedürfnis, zu sammeln, zu kanonisieren, einen Überblick zu kriegen. Das kann man aber auch gegen den Kanon selbst wenden. Es ist eine Reihe für Werke und Figuren, die im Schatten der großen Kanonisierungen geblieben sind. Sie wurden übersehen, weil sie, wie Ludwig Binswanger zum Beispiel, zwischen den Disziplinen standen oder wie Adolf Loos, der durch private Vorwürfe in Verruf geriet, aber auch wegen seiner sehr radikalen Thesen häufig keinen Anklang fand. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, diese Reihe vorab zu definieren, weil sie vor allem über Inhalte gefüllt wird und ich hoffe darauf, dass man aus der Zusammenstellung der Autoren auch schon versteht, in welchem Zusammenhang sie zueinanderstehen. Aber genauso unbewusst funktioniert ja auch der Kanon: Wenn man Sachen als gelbes Reclam-Heft sieht, versteht man sofort: Das ist Weltliteratur, man versteht gar nicht genau, warum das so wichtig ist, aber man versteht: „Das muss man gelesen haben.“ Ich versuche mit den Schattenwerken den Gegenkanon zu kreieren und zu sagen: „Das wurde nicht richtig gewürdigt.“
Was hat Adolf Loos denn geschrieben, das nicht richtig gewürdigt wurde?
Adolf Loos war ein sehr einflussreicher Wiener Architekt, der nicht nur Wegbereiter für die moderne Architektur war (zum Beispiel des Leitsatzes „form follows function“, der ja später in Deutschland vor allem durchs Bauhaus berühmt wurde), sondern auch ein rhetorisch brillanter Kulturkritiker und Kunstphilosoph. Er hat seine provokanten Thesen aber besonders gern in Form von Zeitungsartikeln veröffentlicht, die zu seiner Zeit eine große Wirkung hatten, aber nicht gut zu kanonisieren sind. Er hat sich aber bewusst für diese sehr zeitgebundene Form entschieden, das ist auch ein Teil seiner ästhetischen „Theorie“, wenn man etwas so Praxisgebundenes überhaupt noch Theorie nennen möchte. Damit hatte er enormen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben damals, aber vor allem seine längeren und kunstphilosophischen Essays wie „Ornament und Verbrechen“ werden immer wieder als Pars pro Toto für Loos gelesen, obwohl die Zeitungsartikel auch rhetorisch besonders interessant sind.
Was macht Schattenwerke besonders? Warum sollte ich nicht einfach das Hauptwerk eines Autors lesen?
Es sind nicht nur Nebenwerke, die Schattenwerke sind. Die kleinen Formen der Texte, ihre Kurzweiligkeit und theoretische Pointiertheit, machen sie zum Schattenwerk. Kürzere Textarten wie Essays, Zeitungsartikel, Studien. Aber da verläuft eigentlich nicht die Trennlinie. Die kurzen, theoretischen Texte sind besonders interessant, weil sie sehr einflussreich waren und durch ihre kleine Form trotzdem oft untergingen.
Was bieten Sie uns, was wir sonst nicht bekämen?
Einerseits natürlich die Zusammenstellung. Den schweizerischen Psychiater Binswanger mit dem Vorwort von Foucault gibt es in dieser Zusammenstellung gar nicht mehr zu kaufen. Die Texte sollen immer von einem Vorwort begleitet werden, bei Adolf Loos ist das Christoph Paret, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Wien, und für Max Stirner ist das Wolfgang Eßbach, ein Professor der Soziologie, der ihn kontextualisiert.
Wie finden Sie die Bücher? Durchsuchen Sie Magazine und Journals?
Genau. Durch Lettre International kam ich auf Adolf Loos. Zu Ludwig Binswanger kam ich durch die Foucault-Gesamtausgabe. Foucaults erster Text darin ist über Binswanger. Das hat mich gewundert, weil ich Binswanger vorher noch gar nicht kannte, obwohl ich mich viel mit Foucault beschäftigt habe. Dann habe ich mich unter den anderen Studierenden umgehört und tatsächlich kannte ihn niemand. Ich bin natürlich auch sehr viel angewiesen auf Empfehlungen. Christoph Paret, der das Vorwort für Adolf Loos geschrieben hat, hat auch andere Werke aus seinem Metier vorgeschlagen, die auch in die Reihe passen würden. Diese muss ich dann natürlich auch erst sichten und schauen, ob sie passen, aber so funktioniert es sehr gut. Viele Menschen kommen auf mich zu und schlagen mir Werke vor.
Und wo findet man sie dann genau? Müssen Sie durch die Welt reisen?
Für die Adolf-Loos-Texte habe ich die Bibliothek in Wien kontaktiert. Da gibt es auch schon sehr viel digitalisiert, aber da kommen dann wieder ganz andere Schwierigkeiten auf einen zu. Adolf Loos war die Typografie sehr wichtig. Da gab es eine Ausgabe der ersten Sammlung, bei der es so wirkt, als hätte das einfach jemand mit einem Texterkennungsprogramm gescannt und über Self-Publishing-Wege veröffentlicht. Da war die Schwierigkeit, mithilfe der Originalausgaben zu schauen: Wie wollte er das haben, wie lang genau ist der englische Geviertstrich und wo genau kommt er hin? Er hatte sogar eine starke Meinung zu den Seitenrändern. Bei Binswanger war die Schwierigkeit, eine gute Übersetzung zu finden, dafür musste ich bei Suhrkamp die Rechte anfragen. Bei Max Stirner, der im Herbst erscheint, war zum Beispiel die Auswahl schwierig. Es sind teilweise, wie schon erwähnt, sehr zeitlich gebundene Texte. Stirner bezieht sich auf die Diskussion der Junghegelianer und es ist dann schwierig, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ich ohne zu große Voraussetzungen verstehen kann und wie man das in einem Vorwort verständlich machen kann. Die Reihe ist ja schon für ein breiteres Publikum gedacht, deswegen auch die erschwinglichen Preise.
Sie haben schon gesagt, es ist schwierig, die Reihe zu definieren. Aber haben Sie eine bestimmte Ausrichtung? Wie wählen Sie die Werke aus?
Das Hauptkriterium ist Relevanz, ohne dass sie gewürdigt wurden. Wenn man Stirner zum Beispiel liest, erkennt man überall Nietzsche. Es ist unglaublich zu sehen, was da schon alles drinsteckt. Philosophie ist eben auch das Feld, auf dem ich selbst die Einordnung machen kann, idealerweise möchte ich aber auch Werke aus anderen Fachrichtungen veröffentlichen, aus den Naturwissenschaften zum Beispiel.
Was ist an Ludwig Binswanger so interessant?
Er hat sozusagen Freud weitergeführt. Ich hatte großes Interesse an der Psychoanalyse und da wird ja hauptsächlich Hermeneutik betrieben. Also es wird von den Zeichen auf die Bedeutung geschlossen. Die Psychoanalyse war mein zweites großes Interesse neben Foucault und dem Poststrukturalismus. Die beiden Interessengebiete habe ich immer getrennt voneinander gesehen, Binswanger war aber eine Erleuchtung für mich, weil er gewissermaßen eine Brücke schlägt und ermöglicht, beides zu vereinen. Die Hermeneutik wird durch die Traumdeutung hindurch über sich selbst hinausgeführt. Foucaults Vorwort liefert den Hintergrund, es ordnet nicht nur ein, sondern radikalisiert Binswanger. In Binswangers „Traum und Existenz“ geht es um eine Traumanalyse. Freuds Traumanalyse sieht die Träume als Schlüssel, um den Wachzustand zu verstehen und ordnet sie ihm unter. Binswanger lässt die Träume in ihrer Bildlichkeit stehen, sie sind mehr als Erklärungen und Binswanger lässt ihnen ihre Bildlichkeit.
Welches der Werke, die Sie verlegen hat Sie besonders begeistert?
Max Stirner – das Schattenwerk, das im Herbst erscheint – ist schon ein Liebling. Stirner galt während meines Studiums immer eher als Freak, als moralischer Egoist. Nietzsche wurde dagegen sehr viel ausführlicher behandelt. Es ist einfach interessant zu sehen, wie viel von Nietzsches Thesen schon in Stirner angelegt sind, obwohl er dafür nie gewürdigt wurde.
Heute einen Verlag für Philosophie zu gründen ist ein wirtschaftliches Risiko. Was treibt Sie an?
Es gibt von einem berühmten Verleger das Zitat, er verlege nicht, was die Leute lesen wollen, sondern was sie lesen sollten. Da ich länger das verlegt habe, was die Leute vermeintlich kaufen wollen, möchte ich jetzt verlegen, was die Leute lesen sollten. Ich denke, dass die Leistung eines Verlegers sein sollte, Texte zu vermitteln, die man ohne den Verlag vielleicht nicht gefunden hätte, und genau das soll die „edition schatten“ machen. •
Katharina Wicht hat Philosophie, Literaturwissenschaften und Germanistik in Berlin studiert. Danach hat sie in einem kleinen Kreuzberger Verlag gearbeitet und 2022 den Parrhesia Verlag gegründet.
Weitere Artikel
Katharina Pistor: „Das Finanzsystem ist demokratisch nicht kontrollierbar“
Die rechtlichen Regeln des globalen Finanzkapitalismus werden von einer Handvoll amerikanischer und britischer Anwaltskanzleien geschrieben. Die Juristin Katharina Pistor erklärt im Interview, wie das sein kann, warum Kapital vor allem ein Code ist und wieso wir über Modelle der Vergesellschaftung nachdenken sollten.

Die neue Edition ist da!
Die liberale Weltordnung ist seit einigen Jahren ins Wanken geraten, doch eine neue Ordnung fehlt bisher. Wie könnte sie aussehen? In Gesprächen und Essays blicken herausragende Denkerinnen und Denker auf die großen Fragen in Zeiten des Umbruchs, unterbreiten Deutungs- und Handlungsvorschläge.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
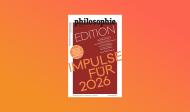
Katharina Hoppe: „Die Neuen Materialismen wollen mit dem Anthropozentrismus brechen“
Viren, Klimawandel und Computer: Die Materie regt sich. Müssen wir das Andere des Geistes als Subjekt anerkennen, ihm Rechte zusprechen – oder beherrscht es uns bald ohnehin? Die Soziologin Katharina Hoppe über die Denkrichtung der „Neuen Materialismen“ – Teil fünf unserer Reihe über Philosophie des 21. Jahrhunderts.

Hermann Schmitz: „Gefühle sind keine Privatsache“
Er ist der große Solitär unter Deutschlands Philosophen. Über Jahrzehnte kaum beachtet, gründete Hermann Schmitz eine eigene Denkschule. Seine „Neue Phänomenologie“ inspiriert heute immer mehr Forscher, gerade auch in Medizin und Psychologie. Ein Gespräch über blinde Flecken, die Macht des Leibes und den unbändigen Willen, eigene Wege zu gehen.

Katharina Sykora: „Der Leichnam kommt der Skulptur nahe“
Bei der Aufbahrung von Papst Benedikt und Pelé wird der Tod als öffentliches Spektakel inszeniert. Die Kunsthistorikerin Katharina Sykora spricht über die Ikonisierung von Körpern, Leichen in der Kunst und die Toten, die unsichtbar bleiben.

Zur Person
Yascha Mounk, ist Politikwissenschaftler und Associate Professor an der Johns-Hopkins-Universität. Darüber hinaus hat er die einflussreiche Zeitschrift Persuasion gegründet und schreibt u.a. für die New York Times, den Atlantic und die ZEIT. 2022 erschien sein Buch Das große Experiment. Wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert (Droemer). Nun ist mit Im Zeitalter der Identität. Der Aufstieg einer gefährlichen Idee (Klett-Cotta) sein neues Buch erschienen. Seit ein Vorwurf der Vergewaltigung gegen ihn bekannt wurde, lässt Yascha Mounk, der diesen Vorwurf zurückweist, sein Amt als Herausgeber der ZEIT vorerst ruhen.

Weniger wählen gehen, mehr Lotto spielen
Die Reform des deutschen Wahlrechts gleicht einer Sisyphosaufgabe. Dabei liegt die Lösung auf der Hand: das Losverfahren. Höchste Zeit, dem urdemokratischen Prinzip mehr Aufmerksamkeit zu schenken, findet Hendrik Buchholz.

Der Lehrer des Despoten
Seneca war ein lebendes Paradox: Als Senator strebte er nach Ehre und Prunk, rief als Stoiker hingegen dazu auf, sich von materiellen Gütern freizumachen. Und doch wurde er von Diderot als „Erzieher der Menschheit“ bezeichnet.
