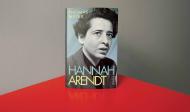Hermann Schmitz: „Gefühle sind keine Privatsache“
Er ist der große Solitär unter Deutschlands Philosophen. Über Jahrzehnte kaum beachtet, gründete Hermann Schmitz eine eigene Denkschule. Seine „Neue Phänomenologie“ inspiriert heute immer mehr Forscher, gerade auch in Medizin und Psychologie. Ein Gespräch über blinde Flecken, die Macht des Leibes und den unbändigen Willen, eigene Wege zu gehen.
„Kommen Sie rein, meine lieben Freunde.“ Wache Augen blitzen aus dem freundlichen Gesicht eines inzwischen gebrechlichen Mannes und weisen den Weg ins Wohnzimmer. Zwischen unzähligen Büchern, Caspar David Friedrichs Gemälden „Mittag“ und „Nachmittag“, einem Plattenspieler und dem schweren Mobiliar der 1960er-Jahre blättert sich das Leben eines genügsamen, aber unbeirrbaren Einzelgängers auf. Seit über 50 Jahren lebt Hermann Schmitz hier im einzigen efeuüberwachsenen Haus einer gutbürgerlichen Wohnstraße in Kiel. Den Blick von seinem Schreibtisch in den Himmel gerichtet, mit seinen Gedanken all dem auf der Spur, was sich durch das reine Denken gerade nicht kontrollieren lässt: Gefühle, Regungen, Leiber, Atmosphären. Gegen den Theorie-Mainstream hat der heute 88-jährige Schmitz als Professor am philosophischen Seminar Kiel ein eigenes, zehnbändiges System der Philosophie entwickelt – immer geleitet von dem Drang, mit seiner Neuen Phänomenologie all jenen Erfahrungen zur Sprache zu verhelfen, für die uns allzu oft die richtigen Worte fehlen.
Philosophie Magazin: Herr Schmitz, beginnen wir im Jahr 1948 – Deutschland liegt in Trümmern, auch moralisch. Sie sind damals 20 Jahre alt und nehmen in Bonn Ihr Philosophiestudium auf. Warum haben Sie sich gerade für die Philosophie entschieden?
Hermann Schmitz: Ich muss wohl auf meinen Deutschlehrer in der Prima, der gleichzeitig außerplanmäßiger Professor an der Universität war, einen so philosophischen Eindruck gemacht haben, dass er der Überzeugung war, ich sollte Philosophie studieren – was im Jahre 1948 nicht ganz leicht war. Er wendete sich also an seinen philosophischen Kollegen, den Herrn Professor Erich Rothacker, und empfahl mich ihm, damit ich, statt in den Bauschutt, sofort in das philosophische Seminar gehen konnte – in irgendeiner untergeordneten Funktion. Und da ich mich mit Herrn Rothacker von Anfang an ganz gut vertrug, obwohl ich ein sehr provokativer Mensch war und nicht der geschickteste im Umgang, so hat sich das ganz von selbst eingespielt. Also, es war kein eigentliches philosophisches Erweckungserlebnis dabei.
Sie haben Kindheitsjahre im Nationalsozialismus erlebt, Ihr Philosophiestudium fiel in die unmittelbare Nachkriegszeit – hat diese historische Umgebung Ihr eigenes philosophisches Anliegen geprägt?
Das ist ohne Zweifel in sehr starkem Maße der Fall, und zwar in politischer Beziehung. Ich war während des Krieges lange krank, sodass ich einigermaßen zurückgezogen lebte und nicht sehr viel mit nationalsozialistischen Organisationen und Militär zu tun hatte. Ich habe also die ganze emotionale Eruption im Nationalsozialismus – die Begeisterung der Massen, den Führerkult – aus einer gewissen Distanz erlebt und mitverfolgt, wie diese politischen Affekte von wenigen Leuten dirigiert werden konnten. Das hat sehr starken Eindruck auf mich gemacht.
Welche Lehren haben Sie damals daraus gezogen?
Für mich hat sich diese Erfahrung in der Erkenntnis niedergeschlagen, dass die vorherrschende Selbstdeutung der Menschen während des Nationalsozialismus einer schwerwiegenden Verzerrung unterlag. Emotionen wurden immer als harmlose Seelenzustände der Einzelnen verstanden. Verdeckt blieb dadurch, dass es tatsächlich Ausbrüche kollektiver Ergriffenheit gab. Diese kollektiven Gefühle wollen aber gar nicht zu unserer klassischen Auffassung von einer in sich abgeschlossenen Seele passen, in der sich irgendwelche Erregungen und Gefühle abspielen. Gefühle sind keine Privatsache, sondern sie können Menschen wirklich überschwemmen. Hier sehen wir also, wie eine verharmlosende Fehldeutung in der Realität üble Folgen haben kann. Diese Lektion hat meine philosophische Arbeit von Anfang an geleitet.
Mit diesem Fokus auf das subjektive Erleben und einer starken Kritik an unserem klassisch abendländischen Verständnis von Körper und Seele dürften Sie aber zu dieser Zeit an deutschen Philosophie-Instituten nicht gerade offene Türen eingerannt haben, oder?
Nein, die Philosophie, vor allem in Deutschland, war in diesen Jahren ganz unfruchtbar geworden. Die Gesellschaft insgesamt erlebte eine emotionale Erstarrung. In der Zeit bis etwa zur Studentenrevolution 1968 dominierte in der deutschen Politik Konrad Adenauer und in der Philosophie Hans-Georg Gadamer. Das waren ungefähr dieselben Richtungen. Beide stehen in ihrem Feld für den Versuch, die Katastrophe zu verdecken durch eine museale Kultur, die stark an die abendländische Tradition anknüpfte. In den letzten Jahrzehnten hat sich die akademische Philosophie aber sehr verändert, die analytische Philosophie hat stark an Einfluss gewonnen. Doch auch ihr fehlen die richtigen Begrifflichkeiten. Wenn sie über Körper und Seele nachdenkt, tut sie das vor allem mit den Mitteln der Logik. Unter dem Deckmantel größtmöglicher Exaktheit verfängt sie sich deshalb in einem sterilen Dialog über Kleinigkeiten.
Worin genau sehen Sie also das große Missverständnis des abendländischen Körper-Geist-Dualismus?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Jens Soentgen: „Die Neue Phänomenologie will die durchschnittliche Lebenserfahrung möglichst genau darstellen“
Was nicht messbar ist, existiert nicht. Das ist das Schema, nach der die naturwissenschaftliche Empirie oft verfährt. Einen Gegenpol bildet die Neue Phänomenologie von Hermann Schmitz, die Gefühle, Atmosphären und diffuses Erleben einbezieht. Ein Interview mit dem Chemiker und Philosophen Jens Soentgen als Teil sechs unserer Reihe Was gibt es Neues im 21. Jahrhundert?

Nicolas Berggruen: Im Angesicht reaktionärer Strömungen muss die Philosophie neue Wege aufzeigen
Das Projekt wurde von Anfang an auch skeptisch beäugt: Im Jahre 2010 gründete der deutschamerikanische Investor Nicolas Berggruen in Los Angeles das Berggruen Institute. Mittlerweile hat dieses die Arbeit aufgenommen, lädt zu Konferenzen, vergibt Stipendien und seit 2016 auch jährlich einen Philosophiepreis – dotiert mit einer Million Dollar. Insbesondere durch den Erwerb (und baldigen Wiederverkauf) der Kaufhausgruppe Karstadt geriet Berggruen, dessen Privatvermögen derzeit auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt wird, in Deutschland stark in die Kritik. Im Interview erklärt er die Gründe, weshalb er fortan vor allem in eines investieren will: philosophische Ideen.
Die Mitte als Problem?
Millionen Menschen protestieren gegen die AfD. Die Mitte scheint den Antifaschismus für sich zu entdecken. Doch übersieht sie dabei ihre eigenen blinden Flecken?

Judith Butler und der Nahostkonflikt
Judith Butlers Text zum Nahostkonflikt hat Wellen geschlagen. Deutsche Kritiker verreißen ihn, sehen aber nicht genau genug hin. Ein differenzierter Blick offenbart blinde Flecken sowohl der Kritiker als auch der Befürworter postkolonialer Positionen.

Jean Améry und die Tortur
Als Folteropfer und Auschwitz-Überlebender zeigt uns Jean Améry, wie Ausgrenzung und Gewalt die Überwältigten versehren. In seiner Phänomenologie der Opfer-Existenz beschreibt er die elementare Wahrnehmungserfahrung eines gequälten Leibes. Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. Und doch muss der Gemarterte die Möglichkeit ergreifen, als freies Subjekt in die Zukunft aufzubrechen.

Netzlese
Fünf philosophische Lesetipps für den Sonntag. Diesmal mit einem Nachruf auf den Religionsphilosophen Klaus Heinrich, der Geschichte von Voltaires Lotteriebetrug, den blinden Flecken Hannah Arendts, der Kollapsologie sowie Peter Sloterdijk über Jogi Löws Frisur.

Moby - Der Klangvolle
Sein wirklicher Name klingt auch nicht schlecht: Richard Melville Hall. Der Nachname „Melville“ führt zurück auf Mobys Ururgroßonkel, den Schriftsteller Hermann Melville, Autor des Klassikers „Moby Dick“. Doch anstatt sich als Walfänger im Rauschen des Meeres zu verlieren, kreiert Moby als Musiker lieber seine eigenen synthetischen Klangwelten. Ein Philosoph der Töne, immer auf der Suche nach dem perfekten Sound, so auch in seinem neuen Werk „Innocents“
Die andere Hannah Arendt
Thomas Meyer lässt die Legenden beiseite und leistet historische Detailarbeit: Seine Biografie erforscht das bisher kaum beachtete zionistische Engagement Hannah Arendts – und ermöglicht einen neuen Blick auf das Leben der Denkerin.