Schönes Sparta
Kriegsmaschine, Totalkontrolle, tristes Leben – unser Sparta-Bild ist traditionell düster. Doch vermutlich ist es das Ergebnis athenischer Feindpropaganda. Waren die Spartaner womöglich ganz anders? Lebensfroh, harmonisch und schön – also: die besseren Griechen?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Mit Hegel und Simmel auf der Fashion Week
Die Pariser Fashion Week für Frühjahr-Sommer 2023 ist in vollem Gange. Aber was genau ist eigentlich ein schönes Kleidungsstück? Hegel und Simmel sind da unterschiedlicher Meinung.

Neapel sehen und sterben
Paolo Sorrentinos neuer Film ist eine Hommage an seine Heimatstadt Neapel und deren mythologische Schutzpatronin „Parthenope“. Der Film verbindet Antikes und Katholisches, Schönes und Groteskes — und fragt nach der Möglichkeit des Wunders in der Moderne.

Gefährliches Geraune?
Der politische Diskurs scheint vom Einfall widervernünftiger Positionen bedroht, die oft als „Geraune“ abgetan werden. Unklar bleibt, was darunter zu verstehen ist. Was also meint das Wort? Und gibt es womöglich einen besseren Umgang?

Bin ich, was ich esse?
Mensch sein heißt, vom Baum der Erkenntnis gekostet zu haben. Mehr denn je steht die Essenswahl heute unter gesellschaftlichem Druck. Selbst gewählte Nahrungstabus bilden das Zentrum unserer Identität, ersetzen zunehmend religiöse und auch politische Bekenntnisse. Die damit verbundenen Haltungen pendeln zwischen lebensfroher Heilserwartung und genussferner Hypersensibilität, revolutionärer Energie und Angst vor staatlicher Überregulierung. Ist gutes Essen wirklich immer gesund? Gibt es überhaupt natürlichen Genuss? Und wenn ja, weist er wirklich den Weg zu globalen Lösungen? Oft, schrieb einst Friedrich Nietzsche, entscheidet ein „einziger Bissen Nahrung, ob wir mit einem hohlen Auge oder hoffnungsreich in die Zukunft schauen“. Hatte er recht?
Mein Moment - Fünf Techniken
Der gelungene Augenblick hat Zufälliges, Unverfügbares an sich. Und doch ist er auch das Ergebnis gezielten Tätigseins. Fünf Menschen erzählen von ihren Techniken, das Jetzt zu erleben.
Rückwärts leben
Sprünge durch die Zeit, so das Ergebnis einer Cambridge-Studie, sind durch simulierte Zeitschleifen möglich – Erfolgsquote: 25 Prozent.
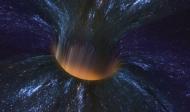
Die neue Sinnlosigkeit des Homo fluxus
Die Forderung nach dem Aufgehen der eigenen Existenz im Beruf trifft auf eine Arbeitswelt, in der die Ergebnisse des eigenen Tuns vor allem durch die Digitalisierung immer schwerer fassbar sind. Wenn Arbeit ohne Werk überhaupt erfüllend sein kann, unter welchen Bedingungen ist dies möglich? Oder entlarvt uns bereits die Hoffnung, unsere Erwerbstätigkeit sollte sinnvoll sein, als willige Sklaven des Systems? In seinem Essay zeichnet Nils Markwardt historisch nach, wie die Arbeit zum vermeintlichen Sinngaranten wurde und wie wir uns dieser Illusion eventuell entledigen können.

Die KI komponiert mit
Im Auftrag der Telekom wurde Beethovens zehnte Sinfonie nun mittels Künstlicher Intelligenz vollendet. Das Ergebnis ist konservative Kunst im Gewand technischer Avantgarde.
