Hauptsache dagegen?
Mit dem Präfix „Anti-“ ruft Dieter Thomä die kämpferischste aller Vorsilbe zum Gefecht auf, die sich entschlossen gegen Versöhnung und Positivität stellt. „Erstmal dagegen“ ist die verweigernde Haltung des „Anti-“, die somit nicht davor gefeit ist, in ein stures Ablehnen zu kippen.
Dieter Thomä ist ein Pionier der Prefix Studies. Seine wöchentliche Reihe über Avant-, Anti-, Re-, Ko-, De-, Dis-, Neo-, Spät-, Trans-, Meta-, Post- ist gleichzeitig der Countdown zu seinem Buch Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe, das im März bei Suhrkamp erscheint.
Lesen Sie hier alle bisher erschienen Texte der Reihe.
„Anti-“
Die Vorsilbe „Anti-“ ist eine Mehrzweckwaffe. An vielen Fronten innerhalb und außerhalb der Philosophie sorgt sie für Kampfstimmung und entfaltet – im Guten, aber auch im Schlechten – eine hohe mobilisierende Kraft. Man denke an „Antifaschismus“, „Antiimperialismus“, „Antikapitalismus“, „Antikommunismus“ oder „Antisemitismus“. Hält man sich an Buchtitel, dann findet man zusätzlich den Anti-Machiavel Friedrichs des Großen von 1740, den Anti-Ödipus von Gilles Deleuze und Félix Guattari aus dem Jahr 1972 sowie Pragmatismus als Antiautoritarismus, ein aus dem Nachlass veröffentlichtes Hauptwerk Richard Rortys.
Die Philosophie im engeren Sinn hat neben „Antirealismus“, „Antireduktionismus“ und „Antiskepsis“ zwei große Klassiker zu bieten: die „Antinomien“, die Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft vorführt, und vor allem die „Antithese“, die seit Sokrates zur Standardausstattung der dialektischen Methode gehört. Zusammen mit ihren Verwandten, dem Widerspruch und dem Gegensatz, hat die Antithese bei Hegel, Marx und vielen anderen reüssiert. Während Sokrates sich in seinen Dialogen oft mit Aporien zufrieden gab, drängen seine neuzeitlichen Nachfolger freilich darauf, den Nahkampf zwischen These und Antithese auf einer höheren Ebene zu befrieden, nämlich dort, wo die Synthese lockt. Glaubwürdig und standfest ist solch eine Synthese nur, wenn sie nicht für einen faulen Kompromiss steht, sondern aus der Hitze der Auseinandersetzung hervorgeht, wenn der „Geist“ also, wie Hegel sagt, „das Negative ins Auge fasst und mit ihm kämpft“. These und Antithese sollen sich aneinander abarbeiten, bis sich eine neue Gemeinsamkeit ergibt. Theodor W. Adorno hat sich schweren Herzens mit dem „Negativen“ begnügt.
Keine Zwischentöne, nichts Unschlüssiges
Während viele andere Vorsilben (wie zum Beispiel Avant-, Neo- oder Post-) eine zeitliche Differenz eröffnen, ist „Anti-“ ganz auf Gegenwart gepolt. Jetzt gilt’s! Damit man gegen etwas sein kann, muss es einen Gegner geben, sonst wirkt der eigene Einsatz wie das Spiel auf einer Luftgitarre. Gelegentlich neigen „Anti-Typen“ dazu, ihren Gegner krampfhaft am Leben zu erhalten, um zu verhindern, dass die Kampfmoral schwindet. Ein trauriges Beispiel dafür liefert die DDR, in der die Berliner Mauer offiziell als „antifaschistischer Schutzwall“ bezeichnet wurde.
Wie kaum eine andere Vorsilbe ist „Anti-“ in der Lage, wilde Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Hier gibt es kein Zögern und Zaudern, keine Zwischentöne, nichts Unschlüssiges. Es ist kein Zufall, dass es zwar Antialkoholiker gibt, aber keine Transalkoholiker, denn wenn es ums Saufen geht, muss man sich entscheiden, und von Letzteren wüsste man gar nicht, wofür sie stehen. In eine ähnliche Richtung weist der Unterschied zwischen „Anti-“ und Postfaschisten. Während Erstere klare Kante zeigen, drücken sich Letztere vor einer Stellungnahme und nutzen das Schlupfloch, Traditionen zu pflegen, ohne sich ausdrücklich zu ihnen bekennen zu müssen.
„Viele Anti-Typen sind Schwächlinge in der Schale von Kraftmeiern“
Es fällt auf, dass die Vorsilbe „Anti-“ ihr positives Gegenstück, die Vorsilbe Pro-, glatt aussticht. Letztere hat keine Chance auf Mitgliedschaft in der ersten Liga. Für etwas zu sein, wirkt vergleichsweise langweilig. Im politischen Diskurs gibt es wohl nur eine einzige prominente Pro-Kombination, nämlich die englische Parole „pro-choice“. Hier spricht man sich dafür aus, dass Frauen sich dafür oder eben auch dagegen entscheiden dürfen, eine Schwangerschaft auszutragen. So steckt in pro-choice doch auch ein „Anti-“. Ansonsten ist bei Pro- deshalb nicht viel zu holen, weil es in vielen Verbindungen eigentlich gar nicht als Stellungnahme „für“ etwas gemeint ist, sondern eine Situation „vor“ etwas beschreibt. Dies gilt zum Beispiel für Problem und Protest. Der Protest geht etymologisch auf das Zeugnis vor Gericht zurück, aber in der politischen Praxis heute geht es fast immer um den Protest gegen etwas. Der Urtyp aller Pro-Kombinationen ist Prometheus, der große Menschenhelfer. Auch in seinem Namen steckt nicht die Befürwortung, immerhin aber das Vorwärtsstreben, das ihn von seinem Bruder Epimetheus unterscheidet. In der Begriffsgeschichte hat diese Idee außer in der abgegriffenen Rede von proaktiven Maßnahmen kaum Früchte getragen.
Zum Erfolg von „Anti-“ hat beigetragen, dass der Kampf gegen Feinde und das Ausmalen von Feindbildern für soziale Kohäsion sorgt. Dass diese Einigkeit sich einem Gegenspieler verdankt, ist freilich peinlich, denn damit verhaken sich die Menschen in dem, wogegen sie sich wenden. Auch deshalb heißt es in einem Zeitungsartikel aus dem Oktober 1848, den – vielleicht – der Dichter und Revolutionär Charles Baudelaire verfasst hat, der „Antagonismus“ sei eine „böse Idee“. Viele Anti-Typen sind Schwächlinge in der Schale von Kraftmeiern. Sie stürzen sich in den Kampf, haben aber keine Ahnung, wofür sie eigentlich sind, und geraten in tiefe Ratlosigkeit, wenn ihr Kampf gewonnen ist. Aus Angst davor suchen sie sich möglichst rasch irgendeinen neuen Gegner, den sie dann verbiestert bekämpfen können. Spätestens dann wirkt die Anti-Haltung borniert. Mit ihr ist kein Staat zu machen und auch kein Spiel zu gestalten. •
Aktueller Tabellenplatz: früher Spitzengruppe, jetzt unteres Drittel
Wichtige Leistungsträger: Antithese, Antifaschismus, Antikommunismus
Besondere Eigenschaft: Stark im Angriff, aber keine eigene Linie
Dieter Thomä ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und lebt in Berlin. Mitte März erscheint bei Suhrkamp sein Buch „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“.
Weitere Artikel
Kulturanzeiger – Dieter Thomä: „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“
In unserem Kulturanzeiger stellen wir in Zusammenarbeit mit Verlagen ausgewählte Neuerscheinungen vor, machen die zentralen Ideen und Thesen der präsentierten Bücher zugänglich und binden diese durch weiterführende Artikel an die Philosophiegeschichte sowie aktuelle Debatten an. Diesmal im Fokus: Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe von Dieter Thomä, erschienen bei Suhrkamp.
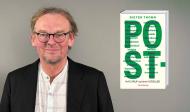
Hängengebliebene Revolutionäre?
Vorsilben verraten mehr über politische Programme und philosophische Systeme, als deren Urhebern lieb sein mag. Dieter Thomä stellt die Mitglieder der ersten Liga der Vorsilben vor. An der Spitze rangiert „Post-“.

Kleine Grammatik des Widerstands
Das Präfix „Re-“ changiert zwischen Wiederholung und Veränderung, Wiederherstellung und Widerstand. Mit dieser Unentschlossenheit kann es aber auch schnell zu Abnutzungserscheinungen bei exzessivem Einsatz kommen, warnt Dieter Thomä.

Entzweien, Zerlegen, Abschaffen
„De-“ und „Dis-“ sind die Spalter im Game der Präfixe und wollen sich abgrenzen, zerstören oder vereinzeln. Sogar die Diversität birgt für Dieter Thomä keine Chance auf Besänftigung.

Dieter Thomä: „Wenn Soldaten Helden sind, dann zweiten Ranges“
Seit Beginn des Ukrainekriegs sind sie wieder in aller Munde: Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum auch Demokratien Helden brauchen, die Gleichsetzung mit Soldaten aber problematisch ist.

Dieter Thomä: „Wer einen guten, wohltuenden Frieden stört, ist einfach nur ein Querulant“
Nach Jahren der Provokation verließ Tübingens Oberbürgermeister letzte Woche die Grünen. Was der Schritt über die Zukunft der Partei aussagt und was Boris Palmer zum produktiven Störenfried fehlt, erläutert der Philosoph Dieter Thomä im Interview.

Gibt es einen guten Tod?
Es ist stockdunkel und absolut still. Ich liege auf dem Rücken, meine gefalteten Hände ruhen auf meinem Bauch. Wie zum Beweis, dass ich noch lebe, bewege ich den kleinen Finger, hebe ein Knie, zwinkere mit den Augen. Und doch werde ich, daran besteht nicht der geringste Zweifel, eines Tages sterben und wahrscheinlich genauso, wie ich jetzt daliege, in einem Sarg ruhen … So oder so ähnlich war das damals, als ich ungefähr zehn Jahre alt war und mir vor dem Einschlafen mit einem Kribbeln in der Magengegend vorzustellen versuchte, tot zu sein. Heute, drei Jahrzehnte später, ist der Gedanke an das Ende für mich weitaus dringlicher. Ich bin 40 Jahre alt, ungefähr die Hälfte meines Lebens ist vorbei. In diesem Jahr starben zwei Menschen aus meinem nahen Umfeld, die kaum älter waren als ich. Wie aber soll ich mit dem Faktum der Endlichkeit umgehen? Wie existieren, wenn alles auf den Tod hinausläuft und wir nicht wissen können, wann er uns ereilt? Ist eine Versöhnung mit dem unausweichlichen Ende überhaupt möglich – und wenn ja, auf welche Weise?

Solidarität als Schafspelz – Warum rechte Solidarität mit Juden nichts wert ist
Seit dem Hamas-Pogrom bekunden einige autoritäre Rechtspopulisten ihre Solidarität mit Israel. Vermutlich aus strategischen Gründen, um ihren Kampf gegen den Islam zu stärken. Doch wie passt das zusammen, da sie historisch das Judentum viel grundsätzlicher ablehnen als den Islam? Eine Analyse.
