Ist was, Kätzchen?
Noch die abstrakteste These wird durch ein Beispiel anschaulich. Jacques Derrida nimmt die Scham vor seiner eigenen Katze zum Anlass, das Tier-Mensch-Verhältnis grundlegend neu zu denken.
Jacques Derrida tritt aus der Dusche. Dabei erblickt der französische Philosoph seine Katze, die in einiger Entfernung auf dem Fußboden seines Badezimmers sitzt und ihn – nackt wie er ist – von oben bis unten durchdringend mustert. Ein starkes Gefühl von Scham ergreift Besitz von ihm und er verspürt den drängenden Impuls, sich ein Handtuch umzuwerfen. Zusätzlich schämt er sich noch für dieses Schamgefühl – das da gegenüber ist doch nur eine Katze!
So ungefähr dürfte sich die Szene abgespielt haben, die der Begründer der Dekonstruktion in seinem Text Das Tier, das ich also bin schildert – ein Titel, der bereits deutlich anzeigt, zu welcher Erkenntnis ihn sein Badezimmererlebnis geführt hat. Für Derrida ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier wesentlich unklarer, als es die philosophische Tradition wollte. Mittels verschiedenster Kriterien hatten fast alle großen Denker der abendländischen Philosophie von Descartes über Kant bis zu Heidegger und Levinas einen tiefen Abgrund zwischen Mensch und Tier gegraben: Letzteres sei wahlweise ohne Sprache, Vernunft oder Würde, könne weder lachen noch trauern noch arbeiten und müsse mithin in Fragen der Moral keine Berücksichtigung finden, so die Auffassung. Bei Kant zum Beispiel haben Tiere den Status von Sachen. Descartes sieht in ihnen nichts weiter als Automaten.
Am Anfang ist die Irritation?
Wie aber ist Derridas Scham zu erklären, wenn es sich bei den Tieren tatsächlich nur um kleine Maschinen handelt? Schämen wir uns etwa vor unserem Badezimmerradio? Vor diesem Hintergrund kritisiert Derrida, dass in der Geschichte der Philosophie das Tier allein schon durch die Sprache verdinglicht wurde. So war fast immer nur von „dem“ Tier im Singular die Rede. Eine unübersehbare Mannigfaltigkeit von Lebewesen wurde unter einer einzigen abstrakten Kategorie zusammengefasst und dem Menschen gegenübergestellt. Für Derrida ist dabei klar, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Umstand, dass wir seit Jahrhunderten nur von „dem Tier“ und unserem Umgang mit den Tieren, den er mit den Begriffen „Unterwerfung“, „Ausbeutung“ und „Vernichtung“ charakterisiert.
Derridas Katze ist kein Ding, sondern ein Wesen, das Scham zu erzeugen vermag und darüber hinaus leidensfähig ist. Dies ist für Derrida eine unleugbare Tatsache und damit der springende Punkt, der uns zu einem völlig neuen Umgang mit Tieren zwingt. Derrida erhebt die Leidensfähigkeit von Tieren zu einem absoluten Wert (für einen Denker der Dekonstruktion durchaus ungewöhnlich). Würde unser Nachdenken über Tiere seinen Ausgang von ihrer Leidensfähigkeit nehmen und würden wir sie philosophisch in ihrer Pluralität anerkennen, würden wir unser Verhalten radikal ändern. Wie doch eine kleine, aber irritierende Erfahrung der Anstoß für eine große Philosophie sein kann! Dass Derrida selbst kein konsequenter Vegetarier war, steht auf einem anderen Blatt. •
Weitere Artikel
Jacques Derrida und die Sprache
Die Sprache – auch die gesprochene – ist ihrer Struktur nach Schrift, so die These Jacques Derridas. Klingt unlogisch? Wir helfen weiter.

Leben und Werk im Widerspruch: Jean-Jacques Rousseau
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Jean-Jacques Rousseau, der trotz seiner radikalen Erziehungsideale seine eigenen Kinder ins Waisenhaus gab.
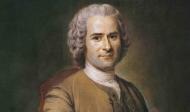
Derrida und Cricket
Als Jugendlicher wollte Jacques Derrida Fußballspieler werden, doch später entwickelte er eine ganz andere sportliche Leidenschaft.
Jacques Rancière: „Es gibt keine Krise der Demokratie, weil es keine wirkliche Demokratie gibt“.
In Frankreich haben Rechtsextreme die Europawahlen gewonnen und könnten auch bei den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli triumphieren. Der französische Philosoph Jacques Rancières schätzt die Lage als dramatisch ein. Ein Gespräch über die Diskurshoheit der Rechtsextremen, Pathologien der V. Republik und die Wahl zwischen Ressentiment und Resignation.

Erkennen Sie die Melodie?
Noch das abstrakteste philosophische Problem wird durch ein Beispiel anschaulich. Für den Phänomenologen Edmund Husserl offenbart sich das Wesen der Zeit in Melodien, die wir vor uns hin summen.

In Stein gemeißelt
Noch die abstrakteste Theorie wird durch ein Beispiel anschaulich. So erklärt Aristoteles anhand einer Marmorstatue die wahren Ursachen unseres Daseins.

Die Stacheln der anderen
Noch die abstrakteste Theorie wird durch ein Beispiel anschaulich. Arthur Schopenhauer legt mithilfe eines Stachelschweins das wahre Wesen unserer sozialen Bindungen frei.

Schleierhafte Gerechtigkeit
Noch die abstrakteste philosophische Idee wird durch ein Beispiel anschaulich. Für den amerikanischen Philosophen John Rawls zeigt erst eine verschleierte Welt ihr wahres Gesicht – und weist den Weg in eine gerechtere Gesellschaft.
