Was bleibt vom Wir?
Mit „Ko-“ bringt Dieter Thomä einen Teamplayer ins Spiel der Vorsilben. „Ko" fragt nach dem Gemeinsamen, den Zusammenhängen, kurz: nach dem Kern der Gesellschaft.
Dieter Thomä ist ein Pionier der Prefix Studies. Seine wöchentliche Reihe über Avant-, Anti-, Re-, Ko-, De-, Dis-, Neo-, Spät-, Trans-, Meta-, Post- ist gleichzeitig der Countdown zu seinem Buch Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe, das im März bei Suhrkamp erscheint.
Lesen Sie hier die bisherigen Texte der Reihe: „Avant-“, „Anti-“ und „Re-“.
„Ko-“
Die Ausbreitung der Vorsilbe „Ko-“ und ihrer Varianten („Kon-“, „Kom-“ etc.) ist stattlich. Sie umfasst „communitas“ mit ihren Ableitungen („Kommune“, „Kommunion“, „Kommunismus“ etc.) sowie auch „Konservatismus“, „Konformismus“, „Kooperation“, „Kombinat“, „Komplex“, „Kontext“ und „Konsens“. Nimmt man das griechische Pendant hinzu, wird die Liste durch „Sympathie“, „Synthese“, „System“, „Synergie“ etc. verlängert. Lässt man auch das deutsche Pendant mitspielen, dann kommen die Heideggerianismen „Mitwelt“ und „Mitsein“ dazu.
Willy Brandts Ausspruch aus dem Jahr 1989 „Es wächst zusammen, was zusammengehört“ ist ein Beispiel, das die Anwendungsmöglichkeiten von „Ko-“ voll auskostet: In der ersten Hälfte des Satzes geht es nämlich darum, einen Zusammenhang herzustellen, in der zweiten Hälfte geht es darum, einen bereits gegebenen Zusammenhang anzuerkennen. Sichtbar wird diese Bandbreite der Bedeutungen an zwei erfolgreichen Einsätzen dieser Vorsilbe in der neueren Theoriegeschichte. Für die Herstellung eines Zusammenhangs steht der „Konstruktivismus“, für die Einbettung der Individuen in eine gegebene Gemeinschaft der „Kommunitarismus“.
Der Drang, das Leben zu teilen
Mit dem Konstruktivismus ist hier nicht eine Kunstrichtung gemeint (Malewitsch! Mondrian!), sondern das dominante methodische Paradigma in den Sozialwissenschaften, das von der „sozialen Konstruktion der Wirklichkeit“ gemäß Peter Berger und Thomas Luckmann bis zu Judith Butlers Rede vom Geschlecht als Konstrukt reicht. Umstritten ist, ob diese Methode sich auf den „kantischen Konstruktivismus“, also die Formierung der Erkenntnis durch transzendentale Kategorien, stützen kann. Ian Hacking hat in seinem Buch The Social Construction of What? versucht, den Einfluss des konstruktivistischen Paradigmas zu begrenzen, aber dies ist ihm nicht wirklich gelungen.
Anders sieht das Bild der Welt aus, wenn man vom Konstruktivismus zum Kommunitarismus wechselt. An die Stelle von Kontingenz und Künstlichkeit tritt die Einbettung des Individuums in eine Gemeinschaft, die ihm vorausgeht. Alasdair MacIntyre, Charles Taylor und Michael Walzer haben den Kommunitarismus stark gemacht und gegen den liberalen Individualismus ins Feld geführt. Der Gründervater Ghanas, Kwame Nkrumah, hat übrigens schon in den 1960er Jahren den „Kommunalismus“, den er den afrikanischen Kulturen zuschreibt, dem westlichen „Individualismus“ entgegengestellt und als eine Art Ursozialismus charakterisiert.
Die Ko-Verbindungen handeln allesamt von Zusammenhängen, die mal als gemacht, mal als gegeben aufgefasst werden. Einmal werden diese verschiedenen Lesarten sogar in einem einzigen Ausdruck zusammengequetscht: Gemeint ist der „common sense“ oder „sensus communis“. Er hat es philosophisch faustdick hinter den Ohren, denn seine Geschichte reicht von Aristoteles über Giambattista Vico und Immanuel Kant bis Hans-Georg Gadamer und Jean-Luc Nancy. An dieser langen Geschichte wird deutlich, wie stark es die Menschen danach drängt, ihr Leben zu teilen.
Der Aufstieg des Streits
Über die Frage, ob diese Teilung zu gestalten und gedanklich zu durchdringen ist, wird anhand des „sensus communis“ gestritten. Mal wird eher „sensus“, also das Verständige, Kognitive betont, mal eher „communis“, also das Gemeinschaftliche, Gegebene. Im Deutschen muss sich der „sensus communis“ mit dem seltsamen Pendant „gesunder Menschenverstand“ herumschlagen, der dem gesunden Volksempfinden arg nahekommt. Vom „Verstand“ ist hier nichts mehr zu merken, eher von Denkfaulheit und von der Vorstellung, dass viele, die gleich ticken, nicht falsch liegen können. Eine attraktive Weggefährtin des „sensus communis“ ist dagegen die „Sympathie“, die zusammen mit „compassion“, „Mitgefühl“ und „Mitmenschlichkeit“ von Anthony Ashley Shaftesbury, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Arthur Schopenhauer und Max Scheler hochgehalten worden ist.
Die Vorsilbe „Ko-“ hat eine ganze Reihe von Gegenspielern – und zwar auch solche, die sich untereinander nicht grün sind. Zu ihnen gehört die „Einheit“ einerseits, die „Vielheit“ andererseits. Der Zusammenhang, der durch „Ko-“ und „Syn-“ hergestellt wird, ist strikt zu unterscheiden von einer Einheit, zu der die Menschen verschmelzen, aber auch von einer Vielheit, bei der die Menschen auf einen großen Haufen geworfen werden. Entsprechend gilt: Der Zusammenklang ist weniger eintönig als der Einklang, weshalb Johann Gottfried Herder das „Consone“ gegenüber dem „Unisonen“ bevorzugt. Zugleich wirkt die „Symphonie“ geschlossener als die „Polyphonie“, und die „commune“ unterscheidet sich von der „multitude“ durch höheren inneren Zusammenhalt.
Zurzeit hat die Vorsilbe „Ko-“ keine Chance auf einen vorderen Tabellenplatz. Die Gründe dafür sind vielfältig. Natürlich hängt ihr immer noch der Niedergang des Kommunismus nach. Dazu kommt, dass der Kommunitarismus seine politische Spitze verloren hat und in Sonntagsreden zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgelagert worden ist. Das auf Émile Durkheim zurückgehende Plädoyer für gemeinschaftliche Solidarität wird in breiten Kreisen vom Loblied der Diversität übertönt. Seit Jean-François Lyotard in der Blütezeit der Postmoderne dem vom Jürgen Habermas geschätzten „Konsens“ vorgeworfen hat, der „Heterogenität der Sprachspiele Gewalt“ anzutun, ist der Dissens zum Gütesiegel der Streitkultur avanciert. •
Aktueller Tabellenplatz: Mittelfeld
Wichtige Leistungsträger: Kommunitarismus, Konstruktivismus, Common Sense
Besondere Eigenschaft: teamfähig
Dieter Thomä ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und lebt in Berlin. Mitte März erscheint bei Suhrkamp sein Buch „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“.
Weitere Artikel
Hängengebliebene Revolutionäre?
Vorsilben verraten mehr über politische Programme und philosophische Systeme, als deren Urhebern lieb sein mag. Dieter Thomä stellt die Mitglieder der ersten Liga der Vorsilben vor. An der Spitze rangiert „Post-“.

Dieter Thomä: „Die USA laufen Gefahr, sich in zwei gänzlich parallele Gesellschaften zu entwickeln“
Viele der Kriminellen, die am 6. Januar das Kapitol stürmten, inszenieren sich als Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum sie genau das Gegenteil sind, die Demokratie aber dennoch „radikale Störenfriede“ braucht.

Die Grade der Gerechtigkeit
Friederike Otto, Franz Mauelshagen und Thomas Piketty erklären, wie Klima, Gesellschaft, Geschichte und Ungleichheit zusammenhängen – und warum das 1,5-Grad-Ziel zu kurz greift. Eine Temperaturmessung.

Dieter Thomä: "Keine Demokratie ohne Störenfriede!"
Was tun, wenn man sich fremd in der eigenen Gesellschaft fühlt? Gar eine radikal andere Welt will? Fragen, die im Zentrum des Denkens von Dieter Thomä stehen. Ein Gespräch über kindischen Lebenshunger, gestörte Männer und die tödliche Sehnsucht nach totaler Ordnung.
Endlich am Ende?
Die Vorsilben „Neo-“ und „Spät-“ springen ins Feld, wenn Begriffe dem Abdanken nahe kommen. „Neo-"will nicht ganz Abschied nehmen und versucht sich auf eine Revitalisierung des Alten und „Spät-“ zögert das unweigerliche Ende ins Unendliche aus, erläutert Dieter Thomä.

Dieter Thomä: „Wer einen guten, wohltuenden Frieden stört, ist einfach nur ein Querulant“
Nach Jahren der Provokation verließ Tübingens Oberbürgermeister letzte Woche die Grünen. Was der Schritt über die Zukunft der Partei aussagt und was Boris Palmer zum produktiven Störenfried fehlt, erläutert der Philosoph Dieter Thomä im Interview.

Kulturanzeiger – Dieter Thomä: „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“
In unserem Kulturanzeiger stellen wir in Zusammenarbeit mit Verlagen ausgewählte Neuerscheinungen vor, machen die zentralen Ideen und Thesen der präsentierten Bücher zugänglich und binden diese durch weiterführende Artikel an die Philosophiegeschichte sowie aktuelle Debatten an. Diesmal im Fokus: Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe von Dieter Thomä, erschienen bei Suhrkamp.
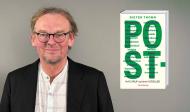
Dieter Thomä: „Wenn Soldaten Helden sind, dann zweiten Ranges“
Seit Beginn des Ukrainekriegs sind sie wieder in aller Munde: Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum auch Demokratien Helden brauchen, die Gleichsetzung mit Soldaten aber problematisch ist.
