Wie regieren in Zeiten des Umbruchs?
Die Umfragewerte des Kanzlers sind schlecht. Gleichzeitig erlebt die AfD einen Höhenflug. Für Juli Zeh ist diese Entwicklung auch das Resultat eines Entfremdungsprozesses zwischen Bürgern und ihren Repräsentanten. Ein Gespräch über falsche Kümmerer-Mentalität und Optimismus in dunklen Zeiten.
Der Nikolaisaal in Potsdam. Auf der Bühne sitzen Olaf Scholz, der in Potsdam zu Hause ist, und die Schriftstellerin Juli Zeh, die im ländlichen Brandenburg lebt und dort Kontakt zu jenen Menschen hat, die den Kanzler in Atem halten. Protestierende Bauern und Bürger, die sich der AfD zuwenden, attestieren der politischen Elite sträfliche Bevormundung und Großstadtarroganz. Andere Teile der Gesellschaft wiederum beklagen an Scholz mangelnde Führungsstärke. Wie kann, wie sollte ein Regierungschef umgehen mit solch entgegengesetzten Vorwürfen? Was bedeutet es, in einer Zeit der Ungewissheit und großen Transformationen ein Land zu leiten? Das Gespräch, maßgeblich gelenkt durch die Schriftstellerin, entpuppt sich bald als eine Art intellektueller Lockerungsübung. Scholz kommt aus der Reserve – und plötzlich wird vorstellbar, wie sie klappen könnte, die Sache mit der Bürgernähe.
Dieser Dialog ist eine gekürzte und überarbeitete Version eines Gesprächs zwischen Juli Zeh und Olaf Scholz, das am 30. Januar im Potsdamer Nikolaisaal stattfand und vom Brandenburger Literaturbüro Potsdam veranstaltet wurde.
Juli Zeh: Herr Scholz, mich würde erst einmal etwas Persönliches interessieren. Sie sind momentan der meistgescholtene Mann der Republik und machen einen unglaublich anstrengenden Job. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt aushält und dabei auch noch Zuversicht ausstrahlen soll. Es gibt zwei Effekte, die das aus meiner Sicht so schwer machen und die ich auch von mir selbst kenne. Das eine ist: Man bekommt 1000 positive Resonanzen und eine miese. Und diese einzige miese Resonanz kann man nicht vergessen, während man die 1000 positiven sofort vergisst. Und das zweite: Die fatalistische Stimmung in der Gesellschaft kocht zunehmend hoch und erfasst manchmal auch mich. Ich habe Tage, da gehe ich raus und denke: „Alles ist katastrophal. Es gibt keinen Ausweg.“ Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Empfinden Sie das auch oder sind das eher meine Wechseljahre?
Olaf Scholz: Was Ihren ersten Punkt betrifft: Ich bin nicht nachtragend, das hilft mir sehr. Das würde mir meine Zeit stehlen, denn eine politische Laufbahn ist doch mit vielen Konflikten verbunden. Manche Dinge, die man so gesagt bekommt, würde man im Alltagsleben als Grund dazu benutzen, mit diesen Menschen nie wieder zu sprechen. Aber ich treffe sie ja meistens am nächsten Morgen wieder. Sorgen macht mir allerdings, dass es manchmal Verfälschungen in den Medien gibt, die riskant sind. Ein Beispiel: Anfang des Jahres, als die schrecklichen Hochwasser waren, habe ich mir die Situation angeschaut und wollte, dass die Menschen, die gegen das Wasser kämpften, wissen: Sie sind nicht alleine. Die Resonanz war sehr gut. Aber diese eine Frau in Niedersachsen, die nach meinem Besuch herumgemeckert hat, hat es damit auf die Titelseite einer großen Zeitung geschafft. Das treibt mich schon um. Denn ich kann ja nicht bestellen, dass sich die Medien um eine realitätsgetreue Darstellung bemühen. Ich kann es nur hoffen.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Edition ist da!
Die liberale Weltordnung ist seit einigen Jahren ins Wanken geraten, doch eine neue Ordnung fehlt bisher. Wie könnte sie aussehen? In Gesprächen und Essays blicken herausragende Denkerinnen und Denker auf die großen Fragen in Zeiten des Umbruchs, unterbreiten Deutungs- und Handlungsvorschläge.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
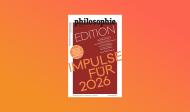
Etwas Besseres als der Optimismus
Der Philosoph Guillaume Paoli erhält für sein Buch Geist und Müll. Von Denkweisen in postnormalen Zeiten den Günther Anders-Preis für kritisches Denken. In seiner Dankesrede, die er am 14. April in Wien hielt, sprach er über sein freiwilliges Außenseitertum, Optimismus als Ideologie und den Todeskuss der Maschine.

Wilhelm Heitmeyer: „Krisen und Kontrollverluste sind die wirkungsvollsten Treiber“
Werden Rechtspopulisten bald zu deutschen Ministern? Wilhelm Heitmeyer forscht seit 40 Jahren zur politischen Rechten. Der Höhenflug der AfD kommt für ihn nicht überraschend. Die Gründe, sagt er, liegen viel tiefer als in einer schlechten Regierungsperformance. Die Zivilgesellschaft müsse konfliktfähiger werden.

Vom Umgang mit Verlusten – und wie wir die Zukunft zurückgewinnen
Geopolitische Umbrüche, Krisen, Kriege: Die moderne Fortschrittserzählung funktioniert nicht mehr, so der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem aktuellen Buch Verlust. Dass alles immer besser wird, ist fragwürdig geworden. Juli Zeh hat eine andere Perspektive: Wir sind, so ihre These, viel zu verlustfixiert, um uns produktiv der Zukunft zuzuwenden. Wie also müssen wir unsere Zeit begreifen? Beim jüngsten Philo.live!-Festival trafen die beiden zum ersten Mal aufeinander.

Die neue Sonderausgabe: Freundschaft
Die Kraft der Freundschaft ist zeitlos. Doch gerade in Phasen des Umbruchs gewinnt sie besondere Bedeutung. Freundschaft stabilisiert, wenn alles andere in Bewegung gerät.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
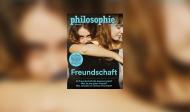
Martin Schulz und die Dialektik des Alltäglichen
Dank ihres neuen Kanzlerkandidaten erreichen die Sozialdemokraten in den Umfragen wieder ungeahnte Höhenflüge. Doch woher kommt diese Begeisterung?
Julian Nida-Rümelin: „Wir müssen anerkennen, dass wir uns immer irren können“
Julian Nida-Rümelin hat seine Erinnerungen vorgelegt. Und gleichzeitig eine Untersuchung über den schwankenden Zeitgeist. Ein Gespräch über Peak Woke, die Probleme des Faktenchecks und Oppenheimer als Film der Stunde.

Giorgio Agamben: „Der Ausnahmezustand ist zur Struktur des Regierens geworden“
Zu Weimarer Zeiten begünstigte der Ausnahmezustand die nationalsozialistische Herrschaft. Im Namen von Terrorbekämpfung und Überwachungsstaat kehre er heute wieder und stelle die Entrechtlichung auf Dauer: ein Gespräch mit dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben.

Kommentare
Zweiparteienwahlrecht durch relatives Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen. Ich wiederhole mich.
Ich danke für den Artikel und die Möglichkeit, zu kommentieren.