Kant
Sonderausgabe 28 - Winter 20242024 jährt sich der Geburtstag Immanuel Kants zum 300. Mal. Zeit, sich das Werk des großen Philosophen aus Königsberg zu vergegenwärtigen. Die Sonderausgabe des Philosophie Magazins bietet eine anschauliche Einführung entlang der kantischen Fragen „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“, die gemeinsam erklären, was Menschsein bedeutet.
Mit Gayatri C. Spivak, Gregor Gysi, Jacques Rancière, Omri Boehm, Susan Neiman, Lea Ypi, Manon Garcia u.v.m.
1. Was kann ich wissen?

Bild: © Christopher Anderson/Magnum Photos/Agentur Focus
Bei der Beantwortung dieser Frage gilt es Kant zufolge zwei Klippen zu umschiffen: Auf der einen Seite müssen wir einen alles zersetzenden Zweifel vermeiden, für den sich sämtliches Wissen in bloße Denkgewohnheiten auflöst. Auf der anderen Seite sollten wir uns auch keinem Dogmatismus verschreiben, der Wissen auf Gebieten behauptet, die sich jenseits aller Überprüfbarkeit befinden. In seiner „Kritik der reinen Vernunft“ analysiert Kant unser Erkenntnis vermögen, verabschiedet sich von der klassischen Metaphysik und gewinnt doch gerade durch die Einschränkung des Wissens „Platz zum Glauben“.
2. Was soll ich tun?

Bild: © Christopher Anderson/Magnum Photos/Agentur Focus
Wichtiger als alle Theorie ist für Kant letztlich die Praxis. Auch wenn sich die Existenz des freien Willens nicht beweisen lässt, müssen wir unbedingt an ihm festhalten, da wir sonst die Möglichkeit moralischen Handelns aufgeben. Unsere Freiheit besteht darin, dem kategorischen Imperativ zu folgen, den Kant in der „Kritik der praktischen Vernunft“ so formuliert: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Doch was folgt aus dieser Aufforderung zur Verallgemeinerung unserer Maximen?
Exkurs: Genie, Rassist oder Spießer?

Bild: © imago
Kant hat keineswegs nur begeisterte Anhänger: Zuletzt häuften sich die Rassismusvorwürfe gegen ihn, schon länger steht sein bürgerlicher Vernunftfetisch in der Kritik. Wo liegen die blinden Flecken seiner Philosophie? Inwiefern war Kant Kind seiner Zeit? Und an welchen Stellen hat er uns noch immer Gültiges zu sagen?
3. Was darf ich hoffen?
Bild: © David Brandon Geeting
Ebenso wenig wie die Freiheit lässt sich Kant zufolge die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele theoretisch beweisen. Und doch haben wir gute Gründe, auf sie zu hoffen. Mit der Hoffnungsfrage befasst sich Kant in seinen Religionsschriften, aber auch in der „Kritik der Urteilskraft“. Hier legt er dar, dass sich etwa in der Erfahrung des Schönen die Kluft zwischen Natur und Freiheit überwinden lasse und, wie er in einer Notiz festhält, sich zeige, dass „der Mensch in die Welt passe“.
Sonderausgabe direkt bestellen!
Alle Texte in der Übersicht
Intro
Warum Kant lesen?
Kant zählt zu den bedeutendsten Philosophen aller Zeiten. Zugleich gilt sein Werk als unzugänglich, trocken und gefühlskalt, zum Teil auch als rassistisch. Was hat uns dieser Klassiker heute zu sagen? Führende Stimmen aus Politik und Philosophie antworten.

Das Leben an sich
Kants Alltag als Professor in Königsberg verlief in geordneten Bahnen, doch er war nicht der oft karikierte „Mann nach der Uhr“. Der große Denker erhob als Gentleman und Gastgeber von Tischgesellschaften die Freundschaft zur Lebensform.

Omri Boehm: „Wir müssen rational sein, um nicht von außen kontrolliert zu werden“
Der israelische Philosoph Omri Boehm versteht Kant, entgegen der gängigen Klischees, als einen Denker des Ungehorsams, gar als Anarchisten. Ein Gespräch über seine Lektüreerfahrung, Kants Freiheitsbegriff und darüber, was uns der Universalismus angesichts des Nahostkonflikts zu sagen hat.

Kantograd
An Kant entzündet sich immer wieder Streit in seiner Heimatstadt Königsberg, dem heutigen Kaliningrad. Je nach Stimmung gilt Kant den Russen als Landsmann oder als Vaterlandsverräter. Zum Jubiläum hat Wladimir Putin Feierlichkeiten angeordnet. Doch wie inszeniert man in Russland die Feier eines Philosophen, der hierzulande als Vordenker internationaler Friedenspolitik gilt?

Quellen der Inspiration
Kants geniale Leistung bestand auch darin, verschiedenartige geistige Einflüsse in seinem philosophischen System zusammenzuführen. So wurde er sowohl von der Physik als auch der Aufklärung beeinflusst und versöhnte den Rationalismus mit dem Empirismus.

Was kann ich wissen?
Marcus Willaschek: „Wir suchen nach abschließenden Antworten“
Die Kritik der reinen Vernunft revolutionierte die Philosophie. In dem Werk untersucht Kant die Leistungsfähigkeit der Vernunft und zeigt, dass gesichertes Wissen über Gott, die Seele und die Welt als Ganzes nicht möglich ist. Marcus Willaschek im Gespräch über die Grundgedanken dieses epochalen Textes.

Das Zeit-Paradox
Die Beschaffenheit der Zeit ist eines der großen Rätsel der Philosophie. Nach Kant ist sie ein fester Bestandteil unserer Art, die Welt wahrzunehmen. Aber folgt daraus, dass sie keine objektive, von uns unabhängige Existenz besitzt?

Jörg Noller: „Wir müssen uns in der KI erkennen“
Zu welcher Art von Erkenntnis ist künstliche Intelligenz fähig? Wichtige Einsichten finden sich bei niemand Geringerem als Immanuel Kant, meint der Philosoph Jörg Noller.
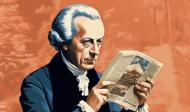
Was soll ich tun?
Jens Timmermann: „Wir sind alle nicht so gut, wie wir sein sollten“
Im Zentrum der Kritik der praktischen Vernunft steht die Freiheit. Unter dieser verstand Kant jedoch etwas anderes als wir heute: Nicht wenn wir unseren Wünschen folgen, sind wir frei, sondern wenn wir dem moralischen Gesetz gehorchen. Jens Timmermann erklärt, warum wir Kant zufolge alle das Gute erkennen, doch nur selten danach handeln.

Moralberatung mit Kant
Im Leben erscheint es uns oft alles andere als klar, was zu tun ist. Die Formulierung des kategorischen Imperativs hingegen ist streng und deutlich – doch was folgt aus ihm für die moralischen Fragen, die sich uns stellen? Hier fünf Beispiele.
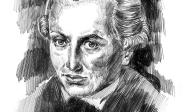
Susan Neiman: „Der Begriff des Bösen ist zentral für Kants Gesamtwerk“
Die Philosophin Susan Neiman hält die Frage nach dem Bösen für ein Leitmotiv in Kants Schriften. Im Interview spricht sie über das Ringen mit einer Welt, in der Tugend und Glück auseinanderfallen. Mit Blick auf die Massaker vom 7. Oktober 2023 erklärt sie, warum man versuchen sollte, das Böse zu verstehen, zeigt aber auch auf, wo das Verstehen an seine Grenzen stößt.

Frieden: Endzweck der Menschheit
Kriege bestimmen derzeit das Weltgeschehen. Der Ruf nach Frieden wird lauter, doch wie wäre er zu erreichen? Kants Schrift Zum ewigen Frieden gibt uns Antworten auf diese Frage.

Lea Ypi: „Der Kapitalismus verstößt gegen das kantische Prinzip“
Ist die Verwirklichung von Freiheit eine Sache des Einzelnen oder der Gesellschaft? Die Philosophin Lea Ypi betont, dass es auch in unterdrückenden Verhältnissen eine unveräußerliche Verantwortung des Menschen gibt. Dennoch muss die Gesellschaft so reformiert werden, dass sich unser moralisches Potenzial entfalten kann.

Was ist guter Sex, Herr Kant?
Soweit man weiß, hatte Kant keine Liebesbeziehungen. Die Ehe definierte der strenge Königsberger lakonisch als Verbindung „zum wechselseitigen Besitz“ der „Geschlechtseigenschaften“. Und doch, so argumentiert Manon Garcia, können wir gerade von Kant viel über die Bedingungen sexuellen Einvernehmens erfahren.

Exkurs: Genie, Rassist oder Spießer?
Was die Kollegen dachten
Nach Kant war in der Geistesgeschichte nichts mehr wie zuvor. Die Philosophen in Kants Nachfolge dachten mit ihm, gegen ihn und über ihn hinaus. Eine Übersicht über die wichtigsten Positionen der Rezeption.

Gayatri C. Spivak: „Kant braucht unsere Hilfe“
Aufgrund rassistischer Äußerungen, eines vermeintlich veralteten Vernunftkonzepts und eines ausgrenzenden Universalismus steht Kant zunehmend in der Kritik postkolonialer Theorien. Im Gespräch geht Gayatri C. Spivak auf die Vorwürfe ein und erklärt, warum Kant nach wie vor eine unverzichtbare Lektüre darstellt.

Bürger Kant
Kant ist der maßgebliche Philosoph des bürgerlichen Zeitalters, das im 18. Jahrhundert mit der Industrialisierung Englands, der Revolution in Frankreich und dem Deutschen Idealismus begann. Urteile über Kant sind daher auch Stellungnahmen zur bürgerlichen Gesellschaft.

Hartmut Böhme: „Die Vernunft hat kein Feuer, kein Licht, keine Wärme“
Kants Philosophie lebt von der Ausgrenzung der Affekte. Die Lust kommt nur als Störfaktor vor – mit fatalen Konsequenzen, argumentiert der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme im Gespräch.

Was darf ich hoffen?
Otfried Höffe: „Kant vermittelt uns eine Hoffnung aus guten Gründen“
Hat das Leben einen Zweck? Wie erlangen wir Zuversicht in einer Welt der Gewalt? Diese Fragen trieben schon Kant um. Ein Gespräch mit dem Philosophen Otfried Höffe über große und kleine Hoffnung, Kants dritte Kritik und darüber, warum uns die KI kategorisch unterlegen bleibt.

Vom Nutzen der nutzlosen Kunst
In jüngster Zeit wird Kunst oft daran gemessen, welche moralischen Inhalte sie vermittelt. Aber wird man dem, was Kunst ausmacht, damit gerecht? Friedrich Schiller, der Kants Ästhetik mit Begeisterung liest, zeigt, dass der moralische Wert in etwas anderem liegt.

Josef Früchtl: „Wir transformieren unsere Sinnlichkeit im Gespräch“
Über Geschmack lässt sich streiten. Aber wie? Im Gespräch über Kants Ästhetik erläutert der Philosoph Josef Früchtl, wie eine Diskussion über Kunst und Schönheit gelingt und weshalb die Lust dabei mehr im Suchen als im Finden liegt.

