Freund und Feind
Die gegenwärtige Debattenlage zeigt: Der Feind ist wieder da. Und damit auch der Vernichtungswunsch. Ein Deutungsversuch des Zeitgeists mit Carl Schmitt.
Hier die Guten, da die Bösen. Viele Geschichten, ob in Filmen oder in Romanen, funktionieren nach diesem Schema. Und natürlich wähnt man sich selbst gern auf der guten Seite. Auf der Seite der Jedi-Ritter, auf der Seite von Winnetou, auf der Seite von Harry Potter. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit schien eine derart klare Aufteilung in hell und dunkel tatsächlich eindeutig in die Welt der Fiktion zu gehören. Oder wahlweise auch in die Welt der Religion, von der Nietzsche meinte, dass sie ihren Begriff des Guten aus einer „Sklavenmoral“ zöge, die das Starke, Herrische als böse abwerte, um die Schwachen triumphieren zu lassen. So dekonstruierte der Philosoph das christliche Weltbild, entlarvte es, wenn man so will, ebenfalls als Fiktion, die sich zu einer nur vermeintlichen Wahrheit verfestigt hat.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Carl Schmitt sitzt nicht im Weißen Haus
Die Außenpolitik der Trump-Regierung scheint auf einen amerikanischen Großraum von Grön- bis Feuerland hinauszulaufen. Das erinnert viele Kommentatoren an die Weltordnungspläne Carl Schmitts. Doch der hätte über Trumps globale Dealmaking-Strategie wohl nur die Nase gerümpft. Schmitts Geist müssen wir heute eher in Peking suchen.

Die Illusion ideeller Kriegsführung
Wann ist es gerechtfertigt, dass Menschen in einem Krieg ihr Leben opfern? Angesichts der Diskussion um europäische Bodentruppen für die Ukraine ist das eine Frage, die zunehmend an Brisanz gewinnt. Für Carl Schmitt ist die Antwort klar: Ein Krieg kann nie ideell begründet werden, sondern nur existenziell.

Juan Carlos Monedero: "Wir brauchen eine Revolution des Gemeinsinns"
Am 24. Mai finden in Spanien Regional- und Kommunalwahlen statt. Die linkspopulistische Bewegung Podemos, 2013 gegründet, liegt in den Umfragen mit den großen Bürgerparteien gleichauf. Ein Interview mit dem Politologen und Podemos-Gründer Juan Carlos Monedero
Produkte des Zeitgeists
Die Objekte, die die Gegenwart hervorbringt, verraten stets auch etwas über deren geistigen Überbau. Eine philosophische Einordnung eines Abnehmmedikaments, superschneller Schuhe und einer App, die unser „wahres Ich“ zum Vorschein bringen soll.

Produkte des Zeitgeists
Die Objekte, die die Gegenwart hervorbringt, verraten stets auch etwas über deren geistigen Überbau. Eine philosophische Einordnung kultiger Latschen, Wände aus Windeln und eines besonderen Gesichtssprays.

Gegen den Zeitgeist
Scharf ist die Kritik an einer Begrenzung der Meinungsfreiheit durch Political Correctness. Doch zeigt sich der Fortschritt einer Gesellschaft nicht auch in respektvoller Sprache und einer neuen Pluralität der Stimmen? Dossier über Wege aus einem verminten Feld.

Die neue Sonderausgabe: Freundschaft
Die Kraft der Freundschaft ist zeitlos. Doch gerade in Phasen des Umbruchs gewinnt sie besondere Bedeutung. Freundschaft stabilisiert, wenn alles andere in Bewegung gerät.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
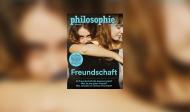
Die Sache mit dem Mineralwasser
Stilles statt sprudelndes Wasser zu bestellen, verweist auf einen Zeitgeist, der die Lust des intensiven Lebens mit den Herausforderungen der Gegenwart nicht mehr zu verbinden weiß. Kolumne von Wolfram Eilenberger.

Kommentare
Carl Schmitt behauptet im Leviathan die ursprüngliche und natürliche Einheit von Politik und Religion: deren Wiederherstellung ist der eigentliche Sinn der politischen Theorie Hobbes‘. Ausgangspunkt der Staatskonstruktion. Angst vor Naturzustands, Ziel ist Sicherheit: Aufgabe des Staats: fordert Gehorsam (Beendigung der Bürgerkriege) & bietet Schutz. Dies wird mit Gewissens- und Meinungsfreiheit entkernt und der Staat wird eine seelenlose Maschine, die Moral nur mehr innerlich. Staatist auctoritas, non potestas, Polizei und Armee funktionieren, von jeder inhaltlich substanzhaften Wahrheit unabhängig: juristisch positivistisch. Alle Ordnung ist im Staatsbegriff, seine Ehre und Würde liegt in organisierter Geschlossenheit und Berechenbarkeit. Berechenbares Legalitätssystem. „nulla crimen, nulla poena sine lege“. Kein Recht auf Widerstand, Gesetzesstaat. Legalität als Legitimität und Recht nur als staatliche Legalität.
Wer in der Politik von Moral redet, lügt daher.
Besser wir folgen nicht Carl Schmitt auf Suche nach Nützlichkeit der wiederbelebten Feindseligkeit. Dass es ihm nicht um Moral geht, sondern eiskalt um das Funktionieren eines Staatsapparats, macht ihn nicht sympathischer. Sein Wert "politische Einheit" ist nichts weiter als eine beschönigende Bezeichnung für Totalitarismus, für Gleichschaltung und Vernichtung von Vielfalt im Denken. Letztlich ist Einheit nicht weit von Einfalt.
Die Wahrheit ist nicht erst Opfer im Krieg, sondern bereits in der Feindschaft. Und nebenbei alles, was bei der Annäherung an die Wahrheit hilft: Zweifel, Kritik (auch Selbstkritik), Analyse, Kommunikation, Ambivalenz, Dialektik, Systemisches Denken, Respekt, Mitgefühl... Die Vernunft liegt bereits in Trümmern, bevor die ersten Bomben fallen. Stattdessen gedeihen Illusionen und Tabus, Duckmäuser- und Denunziantentum, Heuchelei und Verlogenheit.
Feindschaft ist beliebt, nicht nur bei denen, die davon profitieren. Einerseits, weil es das Denken vereinfacht, einseitige und geschichtslose Propaganda ist deutlich weniger komplex und widersprüchlich als die Wirklichkeit. Zum Anderen wegen dem Anschein von Gemeinsamkeit trotz Konkurrenzgesellschaft. Die Vereinzelung und ein Mangel an persönlicher Identität weckt den Wunsch nach Gruppenidentität.
Auch das "Gemeinsam gegen rechts" ist noch lange kein Mitte-Links-Konsens, sondern zum großen Teil Verleugnung der eigenen Tendenzen zum Totalitarismus. Und der ist immer rechts, unhabhängig von ideologischer Begründung. Die Brandmauern gegen rechts sind rein symbolisch, das Feuer ist schon längst auch auf der anderen Seite. Die Parteien der Mitte haben zwecks Wählerstimmen Forderungen der AfD leicht abgemildert selbst übernommen. Wir haben nur noch die Wahl zwischen Altrechts und Neurechts.
Es ist eine Weile her, dass ich Carl Schmitt´s Traktat "Der Begriff des Politischen" im Original gelesen habe. Damals ging es mir - im weitesten Sinne - wie der Autorin Svenja Flaßpöhler: Auch ich fand die von ihr konstatierte Ent-Emotionalisierung der Freund-Feind-Unterscheidung bemerkenswert und durchaus fruchtbar! Was mir dabei - soweit erinnerlich - irgendwie reizvoll, im Grunde auch ziemlich vernünftig vorgekommen sein mag? Dieser Sound einer quasi um Fairneß, ja fast schon um Gerechtigkeit bemühten Feindbestimmung: Eine Tonlage, welche dem Gegenüber immerhin seine Würde zu lassen scheint! Und könnte dieses Format wohltemperierter Sachlichkeit nicht auch handlungsleitend für uns Heutige werden, wenn wir uns denn schon wie die Kesselflicker streiten? In etwa so, als sei dem vielleicht kaltblütigsten aller Meisterdenker eines rechts-autoritären Staats- und Gesellschaftsverständnisses zumindest hier eine ebenso faszinierende wie erhellende, für den gegenwärtigen Diskurs immer noch produktiv-aufklärerische Pirouette gelungen! Nun allerdings - spannenderweise unter dem Eindruck einer Gedankenführung, die keineswegs in dieselbe, zu Teilen aber in eine ähnlich gelagerte Richtung zu zielen scheint - bin ich hinsichtlich jener Schmitt´schen Volte zu einer ganz anderen, zu einer regelrecht konträren Auffassung gelangt.
Vorweg: Natürlich hat es immer schon - in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und Epochen - Feindbilder gegeben, die nicht gänzlich frei von Aspekten einseitiger oder wechselseitiger Achtung, ja Wertschätzung für den jeweiligen Kontrahenten gewesen sind: Ein guter, schöner, wahrhafter, starker oder nützlicher Feind, er gilt und galt da nicht selten mehr als ein schlechter, hässlicher, unaufrichtiger, schwächlicher oder unnützer Freund!
Nichtsdestotrotz darf man annehmen: Der Regelfall ist eine solch positiv-emotionale Würdigung des Feindes eher selten! In einem gefühlsmäßig umfassenden, auf der Tatebene zudem enthemmenden Sinne funktionieren Feindbilder sehr viel besser da, wo sie mit Blick auf das Gegenüber zusätzlich, mehr noch aber vorherrschend von negativ-herabsetzenden Zuschreibungen oder Projektionen getragen sind; außerdem von emotionalen Abwehrhaltungen bis hin zum blanken Hass; schließlich - insoweit der Feind potentiell oder tatsächlich erfolgreicher ist oder zu sein scheint - von Bedrohungs- und Verlustängsten samt typischerweise begleitender Empfindungen wie etwa Frust oder Neid.
All das jedoch sind und bleiben Gefühle; respektive in Gefühlen wurzelnde Einstellungen, Motive oder Wahrnehmungen: Und damit sind sie unbeschadet ihrer negativen Besetzung zutiefst menschlich! Zudem sind solche Gefühle nicht selten verständlich, ja berechtigt: Eben weil es individuell oder gemeinschaftlich agierende Gegenspieler gibt, die solche Gefühlsreaktionen durch ihr eigenes Handeln überhaupt erst herausfordern. Und selbst da, wo solche Gefühlsreaktionen zu Unrecht bestehen oder völlig übertrieben ausgeprägt sein mögen, ja im Grunde oft dem ähneln, was man dem Feind seinerseits gerne unterstellt, sind und bleiben sie immer noch menschlich. Wenn man so will: Allzumenschlich! Sogar dann noch, wenn sie sich ohne Ansehen der einzelnen Person wie ihrer tatsächlichen Eigenschaften pauschal auf ganze Gruppen, Ethnien oder Nationen übertragen.
Denn so hochproblematisch, so vergiftend gerade diese emotionale Abwertung ganzer Kollektive sein mag, so sehr selbiges in grenzenloser Inhumanität enden kann (spätestens dann, wenn sich eine derartige Geringschätzung samt begleitender Aversionen und Ängste gewaltsam oder gar vernichtend äußert): All dem wohnt dessenungeachtet die Chance inne, sich immer einmal wieder ins Humane rückzukoppeln! Sobald man es nämlich mit einem Angehörigen der Feindgruppe zu tun bekommt, welcher den gefühlsmäßig negativen Zuschreibungen eindeutig nicht entspricht: Sobald man sich also - infolge direkter Begegnung oder medial vermittelter Wahrnehmung - genötigt sieht, auf den Menschen zu schauen und nicht auf das ideologisch verfertigte Zerrbild jener Gruppe, der man ihn zurechnet.
Ganz anders steht es dagegen um ein Feinddenken, welches sich intellektuell dazu versteigt, das eigene Handeln wie die eigene Haltung quasi rational, gewissermaßen ohne Zorn und Eifer zu begründen, ja im Duktus der Aufklärung, gar wissenschaftlicher Expertise: Nämlich mit der bloßen Fremdheit an sich, wahlweise dem blanken Anderssein als solchem! Denn dann fallen beide bereits per se dem Urteilsspruch anheim, staats- bzw. gesellschaftsfeindlich zu sein: Völlig unabhängig davon, wie persönlich gut oder schlecht, schön oder hässlich, wahrhaftig oder unaufrichtig, leistungsstark oder leistungsschwach, nützlich oder unnütz der Fremde oder Andere als Einzelmensch sein mag. Hier gibt es daher, ist dieser Weg erst einmal in aller Konsequenz beschritten, keine Haltelinie und kein Zurück, kein emotional gegründetes Residuum mehr. Im Gegenteil, wird ein derartig argumentierender "Vernunftmensch" sagen: Je besser, schöner, aufrichtiger, leistungsstärker oder nützlicher, desto zersetzender und verderblicher sind solche Individuen im Grunde für Staat und Gesellschaft! Denn für einen Aufklärer dieses Schlages beginnt ja genau und gerade hier - mit der Einführung derartig subjektiver wie kontingenter Faktoren - schon die reinste Irrationalität und Gefühlsduselei!
Diese Art Feindbestimmung kommt übrigens nur vordergründig ohne "emotional(e) beziehungsweise moralisch(e)" Aufladung aus, wie Svenja Flaßpöhler meint (wie auch ich selbst bei damaliger Lektüre noch meinte meinen zu können): Vielmehr verschiebt sich in einem derartig gestrickten Ideengebäude die feindselige Emotion wie auch eine Moralität, die den Feind bzw. das Feindliche scheinbar nur beurteilt, um in der faktischen Konsequenz dann auch zu verurteilen, weg vom erlebbaren Einzelfall, weg vom Subjekt, weg vom hautnah erfahrbaren, vom somit subjektzugewandten Eindruck; hin vielmehr zu einer für objektiv gehaltenen wie erklärten Totalität. Und von dieser ist man dann bereit anzunehmen, ja letztendlich zu glauben, sie sei tatsächlich objektivierungsfähig: Also einer erkennenden Vernunft zugänglich! Der konkrete, der wirkliche Mensch wird auf diesem Wege zu einem abstrahierten Ding, welches dann auch wie etwas Dingliches behandelt werden darf; ja welches - schon vom rationalen Interesse her - notwendigerweise wie eine dingliche Verfügungsmasse, wie eine Sache also, behandelt werden muss. Aus dem Muss wiederum resultiert unter der Hand das Sollen! Insofern schießen das materiell-körperliche Interesse wie das emotional-moralische Empfinden - als letzthin nicht mehr kenntlich gemachte, nicht mehr kritisch mitreflektierte Größen - umso wirkmächtiger in eine solcherart hybride, eben grenzenlos vermessene Form der Rationalität ein, welche annimmt, endlich zu sich selbst gekommen zu sein.
Insofern würde Carl Schmitt wohl keineswegs "skeptisch auf unsere Zeit schauen" oder einer "Moralisierung der Feindeskategorie zum ´Bösen´ ... ablehnend gegenüber" stehen, wie Svenja Flaßpöhler annimmt. Er würde vermutlich ganz im Gegenteil hocherfreut und ziemlich hoffnungsvoll auf eine Gegenwart schauen, in der seine Gedankenwelt erneut und vielfach reüssiert! Wir haben es hier mit dem kalt-heißen Glutkern keineswegs nur des Faschismus, sondern so gut wie aller Ideologien zu tun, die das Humanum entkernen, indem sie es entpersonalisieren und verdinglichen, um sodann scheinrational ins Totalitäre, mithin in die blanke Unmenschlichkeit zu kippen. Nicht nur rechte, auch linke und liberale Weltanschauungen waren und sind hier hochanfällig: Man denke etwa an jenen angeblich "Wissenschaftlichen Sozialismus", zu dem im 20. Jahrhundert ein ursprünglich mal kritisch-reflexiver Marxismus gerann! Man denke um nichts weniger an einen libertären, immer wieder neu entgleisenden Kapitalismus, welcher der puren Logik einer entgrenzten Markt- und Eigentumsordnung folgend annimmt, sie bringe bereits aus sich selbst heraus Vernunft und Fortschritt hervor. Es waren und sind stets die leibhaftigen, die wirklich existierenden Menschen, die an solch menschenfeindlichen, weil menschenfernen Ideenkonstrukten leiden oder zugrunde gehen!
Wofür jedenfalls einiges spricht, ohne es hier in aller Breite ausführen zu können: Genau jene ent-menschlichende Feindbestimmung, wie sie nicht nur, aber in dieser begrifflich-intellektuellen Trennschärfe und Fallhöhe vor allem besagter Carl Schmitt in die Welt gesetzt hat, sie dürfte in mindestens zweifacher Weise nach Auschwitz, mitten hinein also in den fabrikmäßig organisierten Massenmord geführt haben. Zum einen: Sie liefert einem damals mehrheitlich rechts-tickenden deutschen Bildungs- und Besitzbürgertum, welches sich gleichwohl für vernünftig, kultiviert, ja aufgeklärt hält, die gewissermaßen philosophisch, ja geradezu wissenschaftlich gegründete Legitimationsgrundlage dafür, vom persönlichen und konkreten Menschsein der inneren wie äußeren Feinde (Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kommunisten, Sozialisten, Liberale, Konservative, "slawische Untermenschen" etc. etc.) schlechterdings absehen zu dürfen, ja absehen zu sollen und zu müssen! Und zum anderen: Jene Feindbestimmung, sie zeichnet bereits einen Weg vor, der wegführt vom anfänglichen Pogrom- und Mob-Charakter eines eher in Totschlägermanier sich auslebenden SA-Staates. In der Tat ja schon inhuman genug: Aber immer noch in quasi brühend heißen Hass-, Rache-, Neid- und Bereicherungsphantasien schwelgend; also nach wie vor im Menschlich-Allzumenschlichen wurzelnd. In gewisser Weise trifft solches auch für den italienischen oder spanischen Faschismus zu: Brutal und blutrünstig allemal, aber auch hier ohne jene perfid-hybride Aufspaltung von Körper, Gefühl und Rationalität. In Deutschland dagegen führt jener von Carl Schmitt vorgezeichnete Weg zumindest denklogisch mitten hinein in den technokratisch vernünftig wie systematisch ausgeklügelt mordenden SS- und SD-Staat eines Himmler, eines Kaltenbrunner, eines Heydrich, eines Eichmann: Ohne sich dies natürlich in den faktischen Konsequenzen einer späteren Wannsee-Konferenz ernsthaft ausmalen oder ausbuchstabieren zu wollen!
Insoweit lässt sich die auf dem Cover des Philosophie-Magazins gestellte Frage - Gibt es die Guten und die Bösen? - zumindest versuchsweise beantworten: Die Guten, die gibt es wohl nicht! Aber die Bösen, sie existieren durchaus: Und sie saßen oder sitzen keineswegs nur an den Hebeln politischer Macht. Manche sitzen oder saßen auch in Gelehrtenstuben, um mit ihren Einlassungen - wie weiland schon Mephisto in Goethes Faust - den ewigen Sinn- und Wahrheitssucher in uns zu blenden und zu verführen: Und in seinen zweifellos brillant formulierten Texten ist Carl Schmitt zwar nicht in jeder Hinsicht, aber eben vielfach und nicht zuletzt ein solcher Blender und Verführer! Daher bedeutet nahezu jede Befassung mit seinen Begrifflichkeiten und Denkfiguren eine stets doppelte Herausforderung: Einerseits sind sie für den Erkenntnisfortschritt nutzbar zu machen; auf der anderen Seite jedoch sind seine Aussagen zwingend daraufhin abzuklopfen, wie Rabulistik und intellektuelle Dämonie, wie Ideenverhunzung und Verstellung am Ende funktionieren: Wohin sie zumindest einmal führen können!
In der ansonsten instruktiv verdichtenden, unvermeidlich auch verknappenden, insgesamt sehr anregenden Einführung von Svenja Flaßpöhler scheint mir genau letzteres nicht an jeder Stelle gelungen. Was aber keinen Schaden darstellt: Nur wenig nämlich ist für den Diskurs produktiver und erfrischender als eine tatsächliche oder auch nur irrigerweise unterstellte Schwachstelle im Gedankengang. Denn wie auch immer: Es hat ganz offenkundig mich, den Leser, dazu motiviert, meine eigene und ursprüngliche Sichtweise überhaupt erst zu überprüfen und zu korrigieren. Wofür ich dankbar bin!