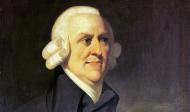Adam Baczko: „Die Taliban sind keine totalitäre Bewegung“
Die Taliban haben wieder die Herrschaft in Afghanistan übernommen. Doch welche Vorstellung vom politischen Islamismus haben jene ehemaligen Theologiestudenten, die zu revolutionären Kämpfern wurden? Der Sozialwissenschaftler Adam Baczko erklärt im Interview die Ideologie der Taliban.
Herr Baczko, welche intellektuelle Ausbildung haben die Ulama, die Rechtsgelehrten der Taliban?
Die Taliban wurden in den Madrasas an der pakistanischen Grenze ausgebildet, religiöse Schulen, die mit der Grundschule beginnen und bis zum Hochschulabschluss reichen. Diese gemeinsame Ausbildung verleiht dem Oberkommando der Taliban ein hohes Maß an soziologischer Kohärenz. Dadurch, dass man sich von klein auf kennt, entsteht ein Netzwerk und gegenseitiges Vertrauen. In den 1980er Jahren wurden diese Schulen stark für afghanische Bürgerkriegsflüchtlinge geöffnet – es war der einzige Ort in der Region, an dem sie eine Ausbildung erhalten konnten. Millionen von ihnen durchliefen diese Madrasas, da es keine andere Ausbildung gab. Dieses Netzwerk hat Ressourcen bereitgestellt, um all jenen Afghanen 40 Jahre lang kostenlose Bildung zukommen zu lassen – was die Sowjets zu der Aussage veranlasste, dass 10 Prozent der afghanischen Bevölkerung Geistliche seien. Dies erklärt, warum die Taliban eine so durchstrukturierte Bewegung sind.
Welche Ansicht vom Islam wird in diesen Madrasas vermittelt?
Die Schulen, in denen die Taliban ausgebildet werden, gehören der Deobandi-Bewegung an, einer religiösen Strömung, die 1867 zur Zeit der britischen Kolonialisierung Indiens entstand, als die Briten das so genannte anglo-muslimische Recht schufen, das die Auslegung des islamischen Rechts durch britische Richter vorsah, die den islamischen Richtern die Hoheit über das islamische Recht im täglichen Leben entzogen hatten. Dies rief damals eine heftige Reaktion in religiösen Kreisen und insbesondere in der Stadt Deoband hervor, wo sich eine geistige Widerstandsbewegung bildete. Es gab das Gefühl, dass die Kolonisatoren die Oberhand gewonnen hatten, weil sie in Bezug auf Organisation und Argumentation überlegen waren. Die Bewegung stützt sich also auf eine doppelte Grundlage: zum einen die Rückkehr zur religiösen Legitimation, die eine Form des Fundamentalismus speist - eine Rückkehr zu den Grundlagen des Glaubens, verbunden mit einer wörtlichen Auslegung der heiligen Texte. Und gleichzeitig ein Bildungssystem, das den rationalistischen Anspruch hat, sich nicht auf religiöse Fragen zu beschränken und den islamischen Klerus nach einer bürokratischen Logik aufbauen will.
Wie unterscheidet sich diese Rückbesinnung auf die Fundamente des Glaubens vom bekannteren Salafismus?
Der Unterschied zum Salafismus und seiner saudischen Variante, dem Wahhabismus, ist zentral und liegt in der Frage des Rechts. Das sunnitische islamische Recht wird in vier Hauptschulen unterteilt, von denen die dominierende der Hanafismus ist, der in den meisten Teilen des Nahen Ostens, in Afghanistan und Indien Anwendung findet. Die Deobandi-Bewegung beruft sich auf diese Schule. Der Wahhabismus hingegen entstand in Saudi-Arabien ab dem 18. Jahrhundert in der Bestrebung, diese klassischen Rechtsschulen in Frage zu stellen. Man warf ihnen vor, juristische Spitzfindigkeiten zu pflegen, die vom wahren Islam ablenken. Der Wahhabismus und der Salafismus haben etwas Protestantisches: Es muss wieder weniger Vermittlung zwischen dem Gläubigen und Gott geben. Der Salafismus wirft den klassischen islamischen Theologen vor, kasuistisch zu sein, besonderen Situationen zu viel Raum zu geben und sich in der übertriebenen Orientierung an Gesetzen zu verlieren. Denselben Vorwurf erheben die Salafisten gegenüber den Taliban. Wenn man die Angriffe des Islamischen Staates auf die Taliban in der Zeitschrift des Islamischen Staates Dabiq liest, so werden sie beschuldigt, Hanafiten zu sein, die sich hinter einer ausgefeilten Argumentation verbergen, um die wahre Religion zu missachten. Dieser kasuistische Geist, gepaart mit ausgefeilten Techniken der Rechtsprechung, ist die Matrix der Taliban. Ihre Anführer sind Juristen mit religiöser Ausbildung. Alle, die ich interviewt habe, meinten, dass ihre Fähigkeit Urteile zu fällen, darauf beruhe, dass sie gelernt hätten, in Einzelfällen zu denken: Sie sind stolz darauf und bekennen sich dazu. Diese unterschiedlichen religiösen Haltungen sind die Grundlage für unterschiedliche politische Theologien. Der Islamische Staat bewegt sich in einer Logik des religiösen Universalismus und hat internationale Ansprüche. Im Gegensatz dazu sind die Taliban Kasuisten: Sie erkennen bestimmte Formen an, den Klerus, die Nation als Form, das spezifisch Afghanische, die Grenzen sowie ihre auf dem indischen Subkontinent verankerte und verortete Präsenz. Der Rest der Welt steht bei ihnen nicht im Fokus. Die Taliban bewegen sich beinahe schon auf Ebene einer religiösen Gemeinde.
Wie hat sich diese Doktrin in der Machtausübung während des ersten Taliban-Regimes von 1996 bis 2001 manifestiert?
Um zu verstehen, was der Gewalttätigkeit ihrer Machtausübung in diesen Jahren zugrunde liegt, müssen wir einen Blick darauf werfen, wie sie selbst die vorangegangenen Jahrzehnte des Bürgerkriegs in Afghanistan darstellen. Für die Taliban ist die Unordnung nicht das Ergebnis eines Konflikts zwischen geopolitischen Kräften vor Ort oder der Unzulänglichkeiten des afghanischen Staates, sondern das Ergebnis eines von den Normen abweichenden individuellen Verhaltens. Es ist die moralische Verderbtheit der Menschen, insbesondere der Städter und der Frauen, die sie besonders ins Visier nehmen und für das kommunistische Regime der 1980er Jahre verantwortlich machen sowie später für die Bruderkämpfe innerhalb der Guerillabewegung in den 1990er Jahren. Um die Ordnung in Afghanistan wiederherzustellen, argumentieren sie wie Richter: Das individuelle Verhalten muss reguliert werden, die Afghanen müssen umerzogen werden, indem alle alltäglichen Dinge durch das Gesetz kontrolliert werden. Das Taliban-Regime ist eine Regierung aus Richtern, allerdings sehr konservativen Richtern aus dem ländlichen Raum. Ein französischer Richter sagte mir einmal: „Was Sie über die Taliban erzählen, ist typisch für die Phantasien von Richtern“, Träume von allmächtigen Richtern, die alle Freiheit haben, das Leben zu regulieren. Es ist eine Bewegung, die ihre Zeit damit verbringt, Normen zu schaffen, bis ins Absurde hinein: Es ging so weit, Krebse und Hummer zu verbieten – in einem Land, das allerdings keinen Zugang zum Meer hat. Die französischen Revolutionäre von 1789 wussten sehr wohl: Zu viele Normen führen zu Willkür, und „das Schweigen des Gesetzes ist für die öffentlichen Freiheiten unerlässlich“.
Nach der großen Unordnung des Bürgerkriegs waren sie also besessen von Ordnung...
Ja, und es muss eingeräumt werden, dass diese Fixierung auf das Gesetz ihnen in einem Kontext extremer Instabilität Glaubwürdigkeit verliehen hat, beispielsweise bei Grundbesitzstreitigkeiten. Bürgerkriege sind eine Zeit großer Rechtsunsicherheit, in der eine Reihe konkurrierender Machthaber Entscheidungen treffen und am Ende weiß man nicht mehr, welche gilt. In jenen Jahren hatte ein afghanisches Dorf Dutzende von Machthabern erlebt, die widersprüchliche Entscheidungen zum Grundbesitz trafen. Nach 43 Jahren Bürgerkrieg war das Land voller ungelöster Besitz-, Handels- und Ehestreitigkeiten, die Blutrache nach sich zogen. Als die Taliban 1996 an die Macht kamen, erwiesen sich ihre Richter als fähig, unparteiisch zu urteilen, aber auch ihre Urteile mit Zwang durchzusetzen, was ihnen ermöglichte, Streitigkeiten beizulegen. Das halten ihnen sogar ihre Gegner zugute. Leute, die gegen die Taliban kämpften und mit denen ich damals sprach, sagten zu mir: „Während ihrer Herrschaft gab es nichts, aber sie haben gute Urteile gefällt.“
Sie konzentrierten ihre strafende Gewalt, also auf die städtische Bevölkerung und insbesondere auf Frauen. Warum?
Durch die wortgetreue Strafanwendung kommt es zu zahlreichen Übergriffen: Hinrichtungen von Frauen auf öffentlichen Plätzen, Steinigungen, Misshandlungen von Personen, die der Homosexualität beschuldigt werden, Ladenbesitzer, die ihre Geschäfte während der Gebetszeiten nicht schließen, werden verprügelt. Die Liste ist lang. Doch obwohl sie den Anspruch haben, die Gesetze streng und genau anzuwenden, sind die Taliban-Richter oft selektiv und stark von der Tatsache beeinflusst, dass sie soziologisch gesehen Männer vom Land sind. Das Problem des Sittenverfalls, das sie umtreibt, ist für sie weniger ein Problem der ländlichen Bevölkerung als der Städter. Als sie Ende der 1990er Jahre eine Verordnung erließen, die besagte, dass Frauen nicht arbeiten dürfen, betraf dies in der Tat Frauen, die in der Stadt, im öffentlichen Dienst, als Lehrerinnen oder Krankenschwestern arbeiteten. Nicht betroffen sind Bäuerinnen oder Handwerkerinnen, die zu Hause arbeiten – sie fallen nicht unter diese Verordnungen. Auch das Tragen der Burka wird hauptsächlich in der Stadt erzwungen; auf dem Land ist sie weiter verbreitet, und paschtunische Nomaden, die die Burka nicht tragen, waren keinen Repressionen ausgesetzt. In den Städten werden Frauen verprügelt, wenn sie sie nicht tragen. Die Frauen, die auf den Feldern arbeiten, ziehen sie aus, weil sie sie bei der Arbeit nicht tragen können. Doch sie werden dafür nicht bestraft. Die Repression konzentriert sich auf die Frauen in den Städten, die zu Sündenböcken gemacht werden. In den 1990er Jahren verloren Frauen aus gebildeten Kreisen den Zugang zu Schulen und Universitäten, Fernsehen und Radio und wurden zu Hause eingesperrt. Ein weiterer Widerspruch besteht darin, dass die Taliban zwar den öffentlichen Raum sehr streng reglementieren, den privaten Raum aber weit weniger. Das liegt daran, dass sie der afghanischen Gesellschaft und ihren Bräuchen sehr verbunden sind, in denen der private Raum unantastbar ist. Sie vermeiden es, sich in familiäre Probleme einzumischen, solange diese nicht eine öffentliche Dimension angenommen haben. Für sie besteht die Aufgabe des Staates darin, alles zu tun, damit das Familienoberhaupt in seinem eigenen Haus herrschen kann, unabhängig davon, ob er ein Tyrann ist und seine Frau und seine Kinder schlägt. Daher ist es ein großes Missverständnis, diese Bewegung als totalitär zu bezeichnen. Es handelt sich um eine zutiefst konservative, patriarchalische Bewegung, die ihre Vorstellung von Gesellschaft sehr brutal durchsetzt, aber nicht versucht, in den privaten Raum einzudringen, wie es die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts taten.
Dennoch haben sie die Spuren anderer Kulturen zerstört, wie zum Beispiel die Buddhas von Bamiyan. Handelt es sich dabei nicht um die Absicht, die vorislamische Geschichte auszulöschen, was sie in die Nähe totalitärer Bewegungen rückt?
Bei der Zerstörung der Buddhas kommen mehrere Phänomene zusammen. Wie der Ethnologe Pierre Centlivre gezeigt hat, ist die Zerstörung dieser Statuen, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden, in erster Linie Teil des Bestrebens, die Vorherrschaft des sunnitischen Regimes über die schiitischen Hazara-Gebiete zu behaupten, die bis 1998 Widerstand leisteten, angefangen mit der Stadt Bamiyan, da diese Buddhas von vielen Afghanen mit der Identität der Hazara in Verbindung gebracht werden. Ihre Zerstörung ist aber auch Teil einer Konfrontation mit den Vereinten Nationen und dem Westen. 1998 wurden die Taliban-Kommandanten, die begonnen hatten, die buddhistischen Statuen zu zerstören, von den Behörden gerügt und 1999 erließ das Taliban-Kulturministerium Dekrete zum Schutz von Altertümern. Im Februar 2001 eroberten die widerständigen Hazara jedoch Bamiyan zurück, bevor sie erneut von Taliban-Truppen zurückgedrängt wurden. In diesem Zusammenhang vollzog Mullah Omar eine Kehrtwende und ordnete die Zerstörung von nicht-islamischen Statuen an, wobei er gleichzeitig zusicherte, dass Sikh- und Hindu-Tempel erhalten bleiben würden. Die Buddhas wurden für die Taliban im Laufe der Zeit zu einem Mittel, ihre Unabhängigkeit angesichts des internationalen Drucks unter Beweis zu stellen.
Wenn wir von den Beziehungen zu anderen Religionen absehen, wie vereinbaren die Taliban die afghanischen Bräuche mit den islamischen Gesetzen?
In diesem Punkt sind sie widersprüchlich: Die Bewegung verbietet offiziell die Ausübung von Stammesbräuchen. Ein Richter räumte mir gegenüber jedoch ein, dass er regelmäßig darauf zurückgreife. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat einmal gesagt, dass man das Recht am besten versteht, wenn man die unrechtmäßigen Vergünstigungen in den Blick nimmt. Der Bereich, in dem die unrechtmäßig verschafften Vorteile der Taliban am meisten ins Gewicht fallen, ist jener, wo es um das Eigentum der Frauen geht. Dies offenbart die Kluft zwischen dem Diskurs der Bewegung und ihrer Praxis, die in der Gesellschaft und ihren Bräuchen verwurzelt ist. Rechtlich gesehen sieht der Islam vor, dass jede Tochter eines Verstorbenen die Hälfte im Vergleich zu ihren Brüdern erbt. Dem Brauch nach – der oft restriktiver ist als der Koran – bekommen die Frauen überhaupt kein Eigentum. Viele Richter gewähren jenen halben Erbanteil in Gerichtsverfahren nicht. Zur Rechtfertigung erklärten mir die Taliban-Richter, dass sie die Mentalität nicht zu abrupt ändern wollten, dass sie pädagogisch bleiben müssten. Dieselben Leute, die die Gesellschaft wieder auf den rechten Weg bringen wollten, koste es, was es wolle, mochten an diesem Punkt nicht das islamische Recht durchsetzen, ohne Rücksicht auf bestimmte Bräuche zu nehmen. Hier zeigt sich die patriarchalische Dimension der Bewegung: Sie will die Familie „wie sie früher war“ wiederherstellen. Eine Familie, wie sie ihren Phantasievorstellungen entspricht, patriarchalisch, in der der Vater alles entscheidet, und wo der große Konflikt geleugnet wird, der in Familien herrscht. Allerdings äußerten die von mir befragten Richter ein Unbehagen darüber, dass sie gegen ihren eigenen Kodex verstießen, denn hier ließen sie ihre juristische Rigorosität und die islamische Rechtsprechung hinter sich.
Die Taliban schüren also eine islamische Revolution, während sie gleichzeitig stark an der alten kulturellen Ordnung festhalten.
Ja, es gibt tatsächlich beides. Die Taliban streben eine konservative Revolution an. Für die Sozialisten des zwanzigsten Jahrhunderts ist eine konservative Revolution ein Widerspruch. Aber die Taliban sind der Beweis dafür, dass es möglich ist. Sie reden ständig davon, zu den alten Zeiten zurückzukehren, die alte Ordnung wiederherzustellen, den Eigentümern ihre Rechte zurückzugeben, den Familienvätern die Autorität im Haus wiederzugeben. Es ist ein Diskurs der Rückkehr zu einer afghanischen Geschichte, die durch ausländische Interventionen unterbrochen worden sei. Es geht darum, die große Zerrüttung des Bürgerkriegs zu beseitigen. Dies ist offensichtlich eine erfundene und umgeschriebene Geschichte. Doch hinter dem Wunsch, wieder eine Kontinuität mit der Vergangenheit herzustellen, verbirgt dieser konservative Diskurs etwas Revolutionäres, denn die Taliban sind bereit, die Eliten und das Legitimationssystem in Afghanistan zu stürzen, um ihre mythische Vergangenheit aufleben zu lassen. Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich die afghanischen Richter und politischen Machthaber säkularisiert und die Taliban negieren diese Säkularisierung. Tatsächlich sind sie dabei, die afghanische Gesellschaft zu verändern, indem sie vorgeben, diese zu ihrem vermeintlich früheren Wesen zurückzuführen. Sie bewirken einen tiefgreifenden Wandel, indem sie behaupten, dass die Legitimation zum Regieren, zur Rechtsprechung und zur Regulierung der sozialen Sphäre von Geistlichen ausgehe. So etwas gab es in Afghanistan noch nie: Das ist eine Revolution. Aus diesem Grund lehnen sie Wahlen ab: Die Wahl sagt etwas über Repräsentativität, nicht über religiöse Legitimation. Die Taliban lehnen Repräsentativität ab und begründen ihre Legitimation auf ihre Kenntnisse in Recht und Theologie.
Wurden sie von ihrem Nachbarland Iran inspiriert, wo nach der Revolution ebenfalls eine sehr vertikal orientierte Theokratie erfunden wurde?
Die Taliban ließen sich hiervon stark inspirieren. Der Iran baute eine theokratische Regierung auf, indem man die anerkannteste Person nach der klerikalen Hierarchie, Ayatollah Khomeini, den höchsten Geistlichen, an die Spitze setzte. Denn die politische Autorität begründet sich auf das religiöse Wissen. Allerdings haben die Taliban in diesem Punkt ein großes Problem: Ihr historischer Führer, Mullah Omar, ist ein einfacher Dorfmullah. Das ist in etwa so, als würde sich bei uns ein Dorfpfarrer zum Papst ausrufen. Mullah Omar hat keine höhere Bildung, sondern nur eine Ehrenurkunde der Dar-ul Ulum Haqqania, der großen Deobandi-Schule in Pakistan. Seine Autorität gründet sich auf eine charismatische Logik. Er sagt, er spreche in seinen Träumen mit dem Propheten und daraus bezieht er seine Legitimation. Mullah Omar ist in den Augen der Taliban ein außergewöhnlicher Mann, der über einen höheren moralischen Sinn als andere Menschen verfügt und von Gott auserwählt ist.
Es klingt, als würde er Ähnlichkeit mit dem Propheten Mohammed reklamieren.
Genau. Als die Taliban 1996 Kabul einnahmen, versammelten sie in den darauffolgenden Wochen als erstes 3.000 Geistliche vom indischen Subkontinent in der großen Moschee von Kherqa Sharif in Kandahar. Im Inneren befindet sich eine für die afghanische Geschichte wichtige Reliquie – der Mantel des Propheten. Mullah Omar nahm ihn aus den Händen der Ulamas der Stadt Kandahar entgegen und wird zum „Befehlshaber der Gläubigen“ ernannt, zum Nachfolger des Propheten – ein Titel, den auch Al-Baghdadi (Oberhaupt des Islamischen Staates) für sich beanspruchte –, damit erhält er den Status des Kalifen, des Vertreters der Autorität des Propheten, den früher der osmanische Sultan innehatte. Diese Szene ist wichtig, um die Taliban zu verstehen: In Afghanistan hatte der Begründer des modernen Staates, Emir Abdul Rahman Khan, Ende des 19. Jahrhunderts am selben Ort und mit demselben Mantel eben diesen Titel angenommen. Als die Taliban ihre Proklamation machen, bewegen sie sich also in einer doppelten Logik: Erstens in einer nationalen Logik, die an die afghanische Geschichte und den afghanischen Staat anknüpft, an den Anspruch der Könige Afghanistans, Vertreter des Propheten zu sein. Doch dieser Anspruch ist im Wesentlichen national und bewegt sich innerhalb der Grenzen des Emirats. Gleichzeitig ist es ein Anspruch auf religiöse Oberhoheit in der gesamten Region: Einer, der damals Mullah Omar die Treue schwor, war Osama Bin Laden. Diese Anspruchserhebung ist für die Erlangung der religiösen Legitimation von entscheidender Bedeutung. Man kann nicht verstehen, welche Kraft in dieser Geste steckt, wenn man nicht sieht, welche Diskrepanz besteht zwischen der Art und Weise, wie die Taliban die Legitimation zum Regieren definieren – die Tatsache, Mitglied des Klerus zu sein und ein Diplom zu besitzen, das die Kenntnis des islamischen Rechts bescheinigt – und der Tatsache, dass ihr Anführer, Mullah Omar, dieses Diplom nicht hat.
Was unterscheidet die prophetische Aura von Mullah Omar von der Aura, die der Islamische Staat ins Feld führt?
Die revolutionäre Eschatologie, die „Lehre von den letzten Dingen“, wie sie der Islamische Staat vertritt, ist eine Eschatologie der Apokalypse, eines bevorstehenden Weltuntergangs. Die Eschatologie der Taliban ist anders, denn es geht nicht um das Jüngste Gericht, sondern um die Wiederkehr der Ordnung, die Wiederkehr eines bestimmten Gerichts – des Urteils der Taliban-Richter.
In den letzten Wochen haben wir in den Nachrichten gesehen, wie die Taliban Twitter benutzen und gutes Englisch sprechen. Was hat sich seit ihrer ersten Übernahme in den 1990er Jahren geändert?
Heute gibt es eine Realpolitik eines neuen Regimes, das versucht, international anerkannt zu werden. Die Führer der Bewegung sind 70 Jahre alt und haben 25 oder 30 Jahre internationale Politik hinter sich. Sie haben gelernt zu kommunizieren, sie benutzen die sozialen Netzwerke, sie haben ein Verständnis diplomatischer Fragen. Auf dem Land regieren sie nun schon seit über zehn Jahren und wissen inzwischen vieles, was es zur Verwaltung Afghanistans braucht, sie haben spezialisierte Ämter geschaffen, sie haben gelernt, mit NGOs zu sprechen, sie haben verstanden, dass sie die Beamten im Amt lassen müssen. Sie wissen auch, dass ihre historische Verbundenheit mit Al-Qaida und deren Mitgliedern, denen sie Unterschlupf gewähren, zu einem Druckmittel werden kann, was sich bereits in ihren Gesprächen mit westlichen Diplomaten andeutet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Taliban im Austausch für einen Sitz bei den Vereinten Nationen einige ihrer Prinzipien verraten werden: Sie wollen vor allem Staatsmänner sein. •
Übersetzung: Grit Fröhlich
Adam Bazcko forscht am Pariser Centre national de la recherche scientifique. Sein Buch „La guerre par le droit – Les tribunaux Taliban en Afghanistan“ (CNRS Éditions) ist soeben erschienen.
Weitere Artikel
Islamismus – Ein moderner Antimodernismus (Teil 1)
Die politische Ideologie des Islamismus hat derzeit mächtig Konjunktur. Dabei ist sie, wie der völkische Faschismus, eine regressive Reaktion auf Freiheit und Unterdrückung zugleich. Sie meint, sich der „Herrschaft des Westens“ zu erwehren, doch bekämpft vielmehr jede Form von Emanzipation. Antisemitismus ist der ideelle Glutkern des vielgestaltigen Phänomens.

Islamismus – Ein moderner Antimodernismus (Teil 2)
Die politische Ideologie des Islamismus hat derzeit mächtig Konjunktur. Dabei ist sie, wie der völkische Faschismus, eine regressive Reaktion auf Freiheit und Unterdrückung zugleich. Sie meint, sich der „Herrschaft des Westens“ zu erwehren, doch bekämpft vielmehr jede Form von Emanzipation. Antisemitismus ist der ideelle Glutkern des vielgestaltigen Phänomens.

„Islamismus ist ein politisches, kein religiöses Phänomen“
Zum Ende des Fastenmonat Ramadan erschütterten eine Reihe von Terroranschlägen des Daesh in Bagdad, Dhaka, Istanbul und Medina die Arabische und Muslimische Welt. Vor allem das Attentat auf die heilige Grabstätte Mohammads in Medina stellt Fragen nach den Zielen und Motiven der Terroristen. Was haben Islam und Islamismus miteinander zu tun? In welchem Bezug zum Koran und zur islamischen Tradition stehen der heutige Fundamentalismus und die gewalttätigen politischen Bewegungen der Gegenwart? Was hat die westliche Moderne damit zu tun?

Die verlorenen Stimmen Afghanistans
Die Taliban nimmt den Frauen in Afghanistan durch das Sprechverbot nicht nur ihre Rechte, sondern versucht, ihre Existenz als handelnde Subjekte insgesamt auszulöschen. Mit Hannah Arendt lässt sich das volle Ausmaß dieser Unterdrückung begreifen.

Totentanz in Iguala
Die Entführung von 43 mexikanischen Lehramtsstudenten einer Landhochschule in Ayotzinapa Ende 2014 hat die ganze Welt bewegt. Die Hintergründe der Tat liegen immer noch im Dunkeln. Unser Autor ist zum Ort des Geschehens gereist, um Antworten zu finden: Wie hängen die dortige Gewalt und die Geschichte Mexikos zusammen? Wie konnte aus dem einst revolutionären Geist des Landes ein Staat erwachsen, in dem der Hobbes’sche Naturzustand, ein Krieg aller gegen alle, herrscht? Und was ist in jener Schreckensnacht wirklich geschehen? Bericht aus einer albtraumhaften politischen Realität.
Was heißt hier Ideologie?
In gegenwärtigen politischen Debatten ist „Ideologie“ ein Kampfbegriff: Ideologen sind verblendet. Der Ideologiekritiker indes wähnt sich über jede Kritik erhaben. Doch gibt es überhaupt einen Standpunkt jenseits der Ideologie? Und was meint dieses Wort eigentlich genau? Eine philosophiegeschichtliche Spurensuche.

Gabrielle Adams: „Man braucht einen Anreiz, um Dinge aus seinem Leben zu entfernen“
Die überwiegende Mehrheit von uns bevorzugt es, Dinge anzuhäufen statt sie loszuwerden. Das haben die Experimente der Psychologin Gabrielle Adams gezeigt. Aber warum ist das so?

Was ist die „unsichtbare Hand“ von Adam Smith?
Der Ausdruck „unsichtbare Hand“ stammt aus dem Denken von Adam Smith, einem bedeutenden Vertreter der schottischen Aufklärung, und ist ein zentrales Konzept des Wirtschaftsliberalismus: Er bezeichnet die Fähigkeit des Marktes, sich selbst zu regulieren. Aber hatte dieser Ausdruck für seinen Urheber nur eine wirtschaftliche Bedeutung?