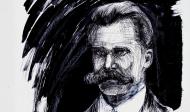Fehlgeleitete Kritik aus Berlin
In einem „Brief aus Berlin“ kritisieren Wissenschaftler die Reaktion der Bundesregierung auf den Nahostkonflikt und den Umgang der Berliner Regierung mit Demonstranten. Die Kritik sei jedoch zu undifferenziert und tatsachenverzerrend, so Christian Thein in einem Gastbeitrag.
Seit Ende Oktober kursiert ein „Brief aus Berlin“ durch die mediale Öffentlichkeit, der sich wortgewaltig und intendiert kritisch einer Vielzahl von Themen zuwendet, die im Zusammenhang stehen mit den Reaktionen einer als „deutsch“ markierten Öffentlichkeit und Politik auf die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten. Wie der Tagesspiegel in einer am 1. November veröffentlichten Vorstellung des Anliegens zusammenfasste, sei die Hauptintention des als „offen“ deklarierten Briefes eine Kritik von Demonstrationsverboten gegenüber sich „mit der Zivilbevölkerung in Gaza solidarisierenden propalästinensischen Demonstrationen“. Der Aufruf konzentriere sich auf eine verfehlte Berliner Landespolitik und rufe im Kern zu einem Mehr an demokratischer Bildungs- und Aufklärungsarbeit und einem Weniger an repressiven Maßnahmen im Berliner Bezirk Neukölln auf.
Einleuchtend an diesen Überlegungen scheint die Einsicht, dass Sanktionen und Verbote kein übergreifend nachhaltiges Konzept für die Antisemitismusprävention auf den Straßen und in den Schulen darstellen. Auch der Aufruf zu „Verständnis für die Vielfalt jüdischen Lebens“ stößt ersteindrücklich bei den Lesern auf wohlwollende Zustimmung – worauf sonst sollte die kritische Auseinandersetzung mit antisemitischen Denkweisen und Handlungsformen abzielen, als darauf, Intoleranz und Vorurteile durch Toleranz zu ersetzen?
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Judith Butler und der Nahostkonflikt
Judith Butlers Text zum Nahostkonflikt hat Wellen geschlagen. Deutsche Kritiker verreißen ihn, sehen aber nicht genau genug hin. Ein differenzierter Blick offenbart blinde Flecken sowohl der Kritiker als auch der Befürworter postkolonialer Positionen.

Marie-Luisa Frick: „Man sollte Selbstdenken nicht undifferenziert heroisieren“
Corona und Terror rufen die Ideale der Aufklärung wieder auf den Plan und stellen die Demokratie gleichzeitig hart auf die Probe. Die Philosophin Marie-Luisa Frick, deren Buch Mutig denken (Reclam) gerade erschienen ist, erklärt vor diesem Hintergrund, was wir heute noch von den Aufklärern lernen können.

Die Engel im Blick – Walter Benjamin und Paul Klees „Angelus novus"
Die Ausstellung Der Engel der Geschichte – Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende im Berliner Bode-Museum rückt Paul Klees Zeichnung Angelus Novus in den Mittelpunkt – und dessen Bedeutung für die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins. Max Urbitsch hat die Ausstellung besucht.

Christian Neuhäuser: „Wenn wir extremen Reichtum verbieten, steigern wir das Innovationspotenzial“
Einem Oxfam-Bericht zufolge ist das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt seit Beginn der Pandemie um eine halbe Billion Dollar gewachsen. Das ist mehr als genug, um Impfstoffe für die Weltbevölkerung bereitzustellen. Im Interview argumentiert der Philosoph Christian Neuhäuser, warum Reichtum dieses Ausmaßes abgeschafft werden sollte.

Christian Bermes: „Meinungen sind kein Ablassbrief, um sich in einem Paralleluniversum einzurichten“
Wir gratulieren Christian Bermes zur Platzierung seines Buches Meinungskrise und Meinungsbildung. Eine Philosophie der Doxa auf der Shortlist des Tractatus 2022. Bereits im Januar haben wir mit dem Philosophen darüber gesprochen, warum Meinungen keine Privatangelegenheit sind.

Der Mythos unterbewusster Manipulation
Eine US-Biermarke versuchte jüngst, Menschen im Schlaf zu beeinflussen, wogegen Wissenschaftler nun mit einem offenen Brief protestieren. Doch verrät der Fall mehr über die Sehnsucht von uns Konsumenten als über die Macht der Manipulation.

Logik der Abschreckung
Lange hatte die Bundesregierung gezögert, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. In seiner Regierungserklärung vollzog Kanzler Scholz dann eine sicherheitspolitische Wende. Diese war überfällig.

Christiane Tietz: „Man kann den ,Zarathustra' gar nicht richtig verstehen, wenn man sich nicht in der Bibel auskennt“
Am 25. August ist der 125. Todestag Friedrich Nietzsches, dem Urheber des berühmten Satzes: „Gott ist tot“. Wie hat das Christentum Nietzsches Denken geprägt? Und was bleibt heute von seiner Religionskritik? Ein Gespräch mit Theologin und Kirchenpräsidentin Christiane Tietz.