Kafka – der Flüchtige
Kafka scheint eindeutigen Zuordnungen und politischen Großprojekten eine Absage zu erteilen. Poststrukturalisten lesen ihn als Autor des Werdens, sein Werk als „Poetik der Nicht-Zugehörigkeit“. Was aber, wenn auch diese Lesart eine Vereinnahmung darstellt?
Große Namen der Literatur werden gern instrumentalisiert. Oft werden sie zu Dichtern eines Volkes erhoben, zu Ikonen des Nationalen gemacht, ihre Texte zum Vehikel des Patriotismus bestimmt. Man könnte meinen, dass Franz Kafka einiges vor solch einer politischen Vereinnahmung bewahrte: Deutsch war zwar die Sprache seiner Literatur, aber als Jude wurde ihm zugleich ein Platz an den Rändern der deutschen Kultur zugewiesen. Zudem war er nie deutscher Staatsbürger, sondern zunächst Österreicher-Ungar und nach dem Zerfall der K.-u.-k.-Monarchie Tschechoslowake. Dass sein Werk erst 2007 vollständig ins Tschechische übersetzt wurde, zeigt, dass er sich auch hier nicht ohne Weiteres in Beschlag nehmen ließ, eben weil er auf Deutsch schrieb und weil er im Kommunismus als bourgeoiser Schriftsteller geächtet war. Hebräisch wiederum lernte Kafka zwar mit gutem Erfolg, doch den Staat Israel gab es zu seinen Lebzeiten nicht und sein Verhältnis zum Zionismus war kompliziert.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
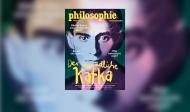
Rüdiger Safranski: „Kafka pflegt einen Absolutismus der Literatur“
Existenzielle Schuldgefühle plagten Kafka, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Ihr Ursprung, meint Rüdiger Safranski, liegt im Konflikt zwischen Leben und Schreiben. Im Gespräch erläutert er, wie Kafka beide Pole fast versöhnt und was seine Texte philosophisch so ergiebig macht.

Kafka – Stationen eines Lebens
Franz Kafka war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Liebhaber, Bruder, Jude, Angestellter, Briefschreiber, Kinogänger.
Die ihn prägenden Beziehungen, historischen Ereignisse und seine wichtigsten Werke zeigt dieser Überblick.

Die rasende Erfinderin
Das Werk der österreichischen Schriftstellerin Raphaela Edelbauer ist ein Kosmos für sich – weit weg von realismusgesättigter Weltverdoppelung. In ihren Poetikvorlesungen Routinen des Vergessens denkt sie jetzt über Literatur und Erkenntnis nach.

Judith Butler und die Gender-Frage
Nichts scheint natürlicher als die Aufteilung der Menschen in zwei Geschlechter. Es gibt Männer und es gibt Frauen, wie sich, so die gängige Auffassung, an biologischen Merkmalen, aber auch an geschlechtsspezifischen Eigenschaften unschwer erkennen lässt. Diese vermeintliche Gewissheit wird durch Judith Butlers poststrukturalistische Geschlechtertheorie fundamental erschüttert. Nicht nur das soziale Geschlecht (gender), sondern auch das biologische Geschlecht (sex) ist für Butler ein Effekt von Machtdiskursen. Die Fortpf lanzungsorgane zur „natürlichen“ Grundlage der Geschlechterdifferenz zu erklären, sei immer schon Teil der „heterosexuellen Matrix“, so die amerikanische Philosophin in ihrem grundlegenden Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“, das in den USA vor 25 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Seine visionäre Kraft scheint sich gerade heute zu bewahrheiten. So hat der Bundesrat kürzlich einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine vollständige rechtliche Gleichstellung verheirateter homosexueller Paare vorsieht. Eine Entscheidung des Bundestags wird mit Spannung erwartet. Welche Rolle also wird die Biologie zukünftig noch spielen? Oder hat, wer so fragt, die Pointe Butlers schon missverstanden?
Camille Froidevaux-Metteries Essay hilft, Judith Butlers schwer zugängliches Werk zu verstehen. In ihm schlägt Butler nichts Geringeres vor als eine neue Weise, das Subjekt zu denken. Im Vorwort zum Beiheft beleuchtet Jeanne Burgart Goutal die Missverständnisse, die Butlers berühmte Abhandlung „Das Unbehagen der Geschlechter“ hervorgerufen hat.
Kafka als Zeichner
Franz Kafka schrieb nicht nur Weltliteratur, wie ein Band mit seinen Zeichnungen enthüllt. In diesen Werken zeigt sich der Humor des großen Schriftstellers. Dieser Text ist zuerst bei Monopol erschienen.

Kafka, mein Körper und ich
Gebrechlich, abstoßend, gar fragmentiert: Immer wieder schreibt Kafka über das schwierige Verhältnis zum Körper. Unsere Autorin entdeckt gerade darin Möglichkeiten leiblicher Befreiung.

Der afrikanische Philosoph der Aufklärung
Kennen Sie Anton Wilhelm Amo? Vermutlich nicht, dabei ist sein Lebensweg ebenso einzigartig wie bemerkenswert. Seiner Heimat am Ufer des Golfes von Guinea im 18. Jahrhundert entrissen und einem deutschen Fürsten „geschenkt“, wird er als erster Schwarzer an einer europäischen Universität Doktor der Philosophie. Ein Lebensweg jenseits der Norm, der vielen Vereinnahmungen Tür und Tor öffnet, aber auch ein Denken freilegt, das es wiederzuentdecken gilt.
