Lässt sich der Pazifismus verteidigen?
Der russische Angriffskrieg stellt das Ideal der Gewaltfreiheit hart auf die Probe. Der Philosoph Olaf L. Müller und der Historiker Jörg Baberowski über naiven und pragmatischen Pazifismus, Menschenbilder und den Umgang mit Nichtwissen.
Die Humboldt-Universität zu Berlin an einem Novemberabend. Heute findet die Buchpremiere von Olaf L. Müller statt: „Pazifismus. Eine Verteidigung“ heißt die Schrift des Philosophen, der sich seit 30 Jahren mit pazifistischen Theorien auseinandersetzt und sich durch Putins Krieg neu herausgefordert sieht. Als Wissenschaftstheoretiker interessiert ihn, welche Rolle Erkenntnisgrenzen und Menschenbilder in unseren politischen Haltungen zu Krieg und Frieden spielen. Seinen eigenen Optimismus reflektiert er genau: Der Philosoph glaubt an das Gute im Menschen. Der Gewaltforscher, der neben ihm sitzt, ist da skeptischer. Jörg Baberowski ist Professor für die Geschichte Osteuropas. Sein Spezialgebiet: der stalinistische Terror. Die Professoren, die beide an der HU lehren, verbindet eine Freundschaft, die sich gerade aus ihren oft konträren Ansichten speist. Die Plätze in der Aula sind eingenommen. Die große Flügeltür wird geschlossen.
Philosophie Magazin: Herr Müller, im Vorwort Ihres Buches schreiben Sie, dass der Ukrainekrieg Sie bewogen hat, eine Verteidigung des Pazifismus zu verfassen. Warum?
Olaf L. Müller: Als dieser widerwärtige Krieg ausbrach, hat man mich wieder und wieder gefragt: „Kannst du jetzt etwa immer noch Pazifist sein?“ Tatsächlich hat der Krieg auch mich verunsichert. In meinem Buch versuche ich herauszufinden, ob sich der Pazifismus noch verteidigen lässt – und wenn ja, in welcher Variante.
Sie verteidigen einen verantwortungsethischen, pragmatischen Pazifismus, nicht aber einen gesinnungsethischen. Was genau ist der Unterschied?
Müller: Die gesinnungsethische Pazifistin braucht nur zu sagen: „Ich bin gegen alle kriegerischen Handlungen, Ende der Durchsage.“ Dann kann sie die Augen fest zumachen und ihr Herz verschließen. Wer so vorgeht, braucht sich mit der gegenwärtigen Kriegswirklichkeit nicht auseinanderzusetzen, denn die moralische Bewertung steht von vornherein fest. In der Verantwortungsethik stehen hingegen die Folgen des Tuns und Lassens im Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund ließe sich eine pazifistische Position so formulieren: Eine kriegerische Handlung ist falsch, insofern sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Leid als ihre Unterlassung in die Welt bringen würde. Nun überschätzt man sich allerdings erkenntnistheoretisch, wenn man glaubt, bei der Entscheidung über Krieg und Frieden die Folgen des eigenen Tuns oder Nichttuns genau genug überblicken zu können. Wir wissen schlicht nicht, ob eine Alternativhandlung besser sein würde beziehungsweise gewesen wäre. Dennoch müssen wir uns entscheiden. Bei dieser verantwortungsethischen Entscheidung, so meine Pointe, trägt jede Seite immer schon ihre eigenen Werte in die Folgenbeschreibung mit hinein. Das geschieht durch die Orientierung an bestimmten Leitprinzipien.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Ist Pazifismus naiv?
Deutschland muss aufrüsten und Europa militärische Stärke beweisen: So fordern viele mit Blick auf die Ukraine-Krise. Aber stimmt das? Hier ein Pro & Contra zwischen Jörg Baberowski und Olaf L. Müller aus unserem Archiv.

Jörg Baberowski: „Man muss die Kränkung über das verloren gegangene Imperium ernst nehmen“
Sogenannte „Russlandversteher“ geraten durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine mehr denn je in die Kritik. Doch wie einen Ausweg finden, wenn im Dunkeln bleibt, warum Putin diesen Krieg führt? Ein Gespräch mit dem Historiker Jörg Baberowski über das Ende der Sowjetunion, kollektive Demütigung und die Schwierigkeit, ein Imperium zu entflechten.

Vier Philosophien des Pazifismus
Von seinen Gegnern wurde Pazifismus oft als Naivität, Feigheit oder sogar als Beihilfe zu Verbrechen bezeichnet – als Untätigkeit, die dem Krieg freien Lauf lässt. Aber stimmt das? Wir lassen diejenigen antworten, die über das Konzept nachgedacht haben – von Tolstoi bis Weber.

Olaf Müller: „Wer die Atomkriegsgefahr glaubt kontrollieren zu können, leidet unter einer Kontrollillusion“
Der Philosoph Olaf Müller ist bekennender Pazifist. Im Ukrainekrieg empfiehlt er dem Westen Zurückhaltung. Ein Gespräch über Unwissen, Waffenlieferungen, die Gefahr des Atomkriegs und das Gute im Menschen.

Marie-Luisa Frick: „Man sollte Selbstdenken nicht undifferenziert heroisieren“
Corona und Terror rufen die Ideale der Aufklärung wieder auf den Plan und stellen die Demokratie gleichzeitig hart auf die Probe. Die Philosophin Marie-Luisa Frick, deren Buch Mutig denken (Reclam) gerade erschienen ist, erklärt vor diesem Hintergrund, was wir heute noch von den Aufklärern lernen können.

Gegen die „Friedenswindbeutel“ – Karl Marx‘ Kritik des bequemen Pazifismus
Seiner generellen Staatskritik zum Trotz plädierte Karl Marx in außenpolitischer Hinsicht dafür, republikanische gegen autoritäre Staaten zu verteidigen, schreibt der Politikwissenschaftler Timm Graßmann in seinem Buch Marx gegen Moskau. Die Haltung der deutschen Linkspartei gegenüber Waffenlieferungen an Kiew hätte der Autor des Kapitals aufs Schärfste kritisiert.
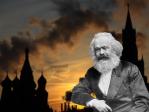
Bewaffnete Nächstenliebe
Die christliche Botschaft wird oft mit Pazifismus gleichgesetzt. Ein fataler Irrtum: Aus Sicht der Bibel erscheint die militärische Solidarität mit der Ukraine nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, meint unsere Kolumnistin Nora Bossong.

Étienne Klein: „Wenn Einstein heute unter uns wäre, würde er die gleichen Dinge sagen wie 1933“
Der Physiker Étienne Klein erinnert an Albert Einsteins Worte aus dem Jahr 1933, als er gegen einen Pazifismus Stellung bezog, der seiner Meinung nach übertrieben und angesichts des Ernstes der Umstände unangemessen war.
