Meer denken
Auch in Zeiten der Pandemie zieht es Millionen von Menschen zum Urlaub an die Küsten. Denn die See verspricht nicht nur Erholung, sondern in ihr spiegelt sich auch die menschliche Existenz. Eine kleine Philosophie des Meeres.
Ein strahlendes Blau, der Wind treibt lediglich ein paar seichte Wellen ins Wasser. Ansonsten: mediterrane Weite. Es reicht bisweilen ein einzelnes Bild, um maritime Sehnsüchte zu triggern. So wie die finale Einstellung in Jean-Luc Godards Le Mépris. Obwohl der Film mit Michel Piccoli und Brigitte Bardot über zwei buchstäblich bildschöne Hauptdarsteller verfügt, ist es der abschließende Schwenk aufs leuchtende Mittelmeer, der ästhetisch aufs Ganze geht – und damit en passant eine Reihe von Assoziationen aufruft: Der salzige Geschmack der Luft, das versöhnliche Rauschen in den Ohren, die arrogante Melancholie der Möwen.
Es sind nicht zuletzt derlei Sehnsüchte, denen jedes Jahr Millionen von Menschen folgen, um ihren Urlaub an den Stränden, Buchten und Lagunen der Welt zu verbringen. Ganz gleich, ob Atlantik, Amalfiküste oder Ahrenshoop: Das Meer erzeugt ozeanische Gefühle. Doch erschöpft sich das Verlangen nach Meer keineswegs nur im touristischen Erholungsbedürfnis. Es vermag ebenso zur existenziellen Erfahrung zu werden.
Denn selbst alkoholorientierte Erlebnisurlauber dürften in nüchternen Momenten die eigentümliche Dialektik von Wassermassen erahnen: In ihrer flüssigen Unendlichkeit verdichten sich die Fragen des menschlichen Daseins. Offenbaren sich Seelandschaften immer auch als Seelenlandschaften, sind Mensch und Meer seit jeher auf das Engste verbunden: zugleich Freund und Feind, Sehnsucht und Abgrund. Wer ans Wasser kommt, wird nämlich mit mindestens drei maritimen Grundgefühlen konfrontiert, die in ihrer tiefen Ambivalenz konstitutiv für die menschliche Existenz sind: Freiheit, Ehrfurcht und der Wille zum Wissen.
Versucht man diese maritimen Grundgefühle genauer in den Blick zu nehmen, ist dieser zunächst von allerlei Folklore verstellt: Strandgut-Nippes, „urige“ Anker-Romantik oder verklärende Seemannsnostalgie. All das muss man gar nicht kulturkritisch denunzieren, nicht zuletzt, weil das Bedürfnis nach Meer bereits so oft literarisch beschrieben und touristisch beworben wurde, dass es aus heutiger Sicht kaum noch ein strandnahes Narrativ gibt, dass komplett ohne Kitschverdacht auskäme. Dennoch – oder womöglich auch: gerade deswegen – lohnt es sich, ozeanische Befindlichkeiten einmal fernab allzu folkloristischer Verstellungen zu betrachten.
Intellektuelle Ausschiffung
Beginnen lässt sich beim ersten maritimen Grundgefühl: Freiheit. Vermag der Blick aufs Meer zuverlässig die müden Augen urbaner Ausflügler zu entspannen, firmiert er ebenso als entscheidender Kniff, um intellektuelle Knoten im Kopf zu lösen. Das zeigt sich exemplarisch bei Friedrich Nietzsche. Als dieser 1867 in Genua das erste Mal das Meer sah, erkannte er in diesem eine Entsprechung seines eigenen Denkens, das mit allen Altlasten der Philosophiegeschichte brechen wollte. Davon zeugen noch Zeilen aus der 1882 veröffentlichten Fröhlichen Wissenschaft: „Dorthin – will ich, und ich traue / Mir fortan und meinem Griff. / Offen liegt das Meer, ins Blaue / Treibt mein Genueser Schiff.“ Hatte Nietzsche mit der Revolutionierung des Denkens in der Zwischenzeit dann auch ernst gemacht, notierte er im selben Buch konsequenterweise: „[E]ndlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es niemals ein so ,offnes Meer'.“
Dass die See einem atmosphärisch eine Art inneren Möglichkeitsraum aufschließt und damit alte Gewissheiten ins Wanken bringt, ist also keineswegs nur eine schummrige Momentaufnahme, die einen nach zwölf Bier und fünfzehn Schnäpsen an der Playa de Palma überkommt, sondern ebenso philosophisch verbürgt. Denn neben Nietzsche konstatierte Ähnliches auch Karl Jaspers. Der an der Nordsee aufgewachsene Denker schrieb 1967 in seinem Selbstportrait: „Das Meer ist die anschauliche Gegenwart des Unendlichen. Unendlich die Wellen. Immer ist alles in Bewegung, nirgends das Feste und Ganze in der doch fühlbaren unendlichen Ordnung.“
Vermag der uferlose Blick innere Grenzen aufzulösen, so schärft das jedoch nicht nur den Sinn für die eigene Freiheit, sondern ebenso für die damit einhergehende Verantwortung, ja für das existenzielle Risiko, das damit notwendigerweise verbunden ist. So war auch Nietzsche bewusst, dass die intellektuelle Ausschiffung auf den offenen Ozean seine Tücken hat, denn „es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass er unendlich ist und dass es nichts Furchtbareres gibt, als Unendlichkeit.“ Ebenso identifizierte Jaspers eine tiefe Ambivalenz des maritimen Imperativs: „Das Philosophieren wird ergriffen von der Forderung, es aushalten zu können, dass nirgends fester Boden ist, aber dadurch der Grund der Dinge spricht. Das Meer stellt diese Forderung. Dort ist keinerlei Fesselung. Das ist das unheimlich Einzige des Meeres.“
Doch zeigt sich das maritime Freiheitsversprechen nicht nur auf individueller Ebene. Die Weiten des Ozeans entfesselten stets auch kollektive Utopien. Eine davon formulierte der niederländische Frühaufklärer Hugo Grotius in seinem 1609 erschienen Manifest Mare Liberum. Hier war der Titel Programm. Für Grotius, der heute als einer der Väter des Völkerrechts gilt, sollte das Weltmeer frei sein. Und zwar in dem präzisen Sinn, dass nationale Besitzansprüche konsequent zurückgewiesen werden müssten. Während auf dem Land das Privateigentum zwar nötig geworden wäre, weil Boden und Vieh von Bauern versorgt werden müssten, existiere das Weltmeer hingegen ohne menschliches Zutun. Deshalb dürften Fischer ihm zwar ihren Fang entnehmen, es selbst müsse jedoch globaler Gemeinbesitz bleiben.
Wassergrenze zur Realität
Obschon es heute internationale Gewässer und das damit verbundene Seerecht gibt, ist Grotius' Idee vom kollektivistischen Weltmeer eine Illusion geblieben, was einem die zwischenstaatlichen Konflikte um maritime Bodenschätze regelmäßig vor Augen führen. Ganz aktuell offenbart sich das etwa im eskalierenden Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgasbohrungen im Mittelmeer. Gleichwohl war Grotius' Vision vom mare librum, darauf weist auch Gunter Scholtz in seiner exzellenten Philosophie des Meeres hin, nicht die einzige schaumgeborene Utopie. Ganz im Gegenteil. Besieht man nämlich die Ideengeschichte des idealen Staats, so ist letzterer fast immer auf Inseln angesiedelt, welche wiederum ja schon etymologisch zum Meer gehören, da sie das Land in salo, also in der Salzflut sind. Ob Atlantis, Thomas Morus' Utopia oder Tommaso de Campanellas Sonnenstaat: Die Vorstellung der vollkommenen Welt brauchte offensichtlich eine Wassergrenze zur herrschenden Realität.
In diesem liquiden Limes offenbart sich aber ebenfalls die radikale Ambivalenz des maritimen Freiheitsversprechens. Lesen sich die Schriften von Morus und Co. aus heutiger Sicht doch in weiten Teilen weniger als utopische Verheißungen denn als intellektuelle Baupläne totalitärer Theokratien. Folglich ist es vielleicht auch nicht allzu verwunderlich, dass die insulare Existenz im weiteren Verlauf der Kulturgeschichte immer weniger als Ausdruck utopischer Ungebundenheit, sondern vielmehr als Parabel auf das Ausgesetztsein in Salzwasserwüsten firmiert. Von Daniel Defoes Robinson Crusoe über H. G. Wells Die Insel des Dr. Moreau bis zu Filmen wie Cast Away erscheint das Inselleben zunehmend als erzwungene Isolation, weshalb es nicht nur geographisch sondern auch ideengeschichtlich konsequent wirkt, dass weit entfernte Eilande wie St. Helena oder Australien in der Moderne zu bevorzugten Verbannungsorten für Ex-Kaiser und Kriminelle avancierten.
Von hier aus gelangt man dann direkt auch zum zweiten maritimen Grundgefühl: ängstliche Ehrfurcht. Dass sich die ruhige See binnen Stunden in eine monströse Naturgewalt verwandeln kann, die, aufgepeitscht durch Stürme, lebensbedrohliche Wassermassen über das Land treibt, weiß jeder, der regelmäßig die Nachrichten verfolgt. Doch nicht nur ob seiner meteorologischen Unberechenbarkeit hatte die See über Jahrhunderte keinen guten Ruf. Eine kulturhistorisch lang gehegte Skepsis gegenüber dem Meer offenbart sich etwa schon darin, dass es in der kollektiven Wahrnehmung im Wesentlichen erst ab der Romantik konsequent als „blau“ erschien. Bis dahin, so konstatiert Dieter Richter in seinem überaus lesenswerten Buch Das Meer – Geschichte der ältesten Landschaft, wurde es hingegen oft als „schwarz“, „dunkelbraun“, „grau“ oder „grün“ beschrieben. Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass das Meer bis in die Moderne oft als Ort des Teufels und Hort von Ungeheuern galt, unter denen der Leviathan, eine Mischung aus Riesenkrokodil und Drache, der Thomas Hobbes' gleichnamigen Hauptwerk den Titel gab, eines der gefürchtetsten war. So irrational derlei mythische Monstergeschichten heute freilich wirken, hatten sie dennoch eine rationale Grundlage. Denn das Meer war und ist, mit den Worten der Schriftstellerin Marie-Luise Kaschnitz gesprochen, „die große Landschaft der Toten“.
Sind Schiffskatastrophen wie jene der Titanic oder zuletzt der Costa Concordia mittlerweile eher eine Seltenheit, gehörte das Aufgrundllaufen, Kentern und Zerschellen von Booten über Jahrtausende indes zum nautischen Alltag. Und selbst wenn transozeanische Passagen oder die Durchquerung des Ärmelkanals, zwei der gefährlichsten Routen der frühen Neuzeit, ohne Schiffbruch überstanden wurden, konnte der Menschenverlust durch Verhungern, Skorbut oder allgemeine Entkräftung dennoch extrem hoch sein. Im 18. Jahrhundert lag die Sterblichkeitsrate auf holländischen Schiffen Richtung Batavia, dem heutigen Jakarta (Indonesien), beispielsweise bei rund fünfzig Prozent. Drei Jahrhunderte später ist das maritime Massensterben indes immer noch nicht Geschichte. Es findet zwar nicht mehr auf den nunmehr technisch hochgerüsteten Handels- und Forschungsschiffen statt, dafür aber in überfüllten Kähnen und Gummibooten, in die Flüchtlinge von ihrer Verzweiflung getrieben wurden. Und deren Tod wird von vielen europäischen Politikern lediglich achselzuckend hingenommen, ja bisweilen sogar kaum verhohlen als nötige „Abschreckung“ verbucht.
Angstlust
Das Meer vermag jedoch nicht nur selbst zum Massengrab zu werden, sondern diente auch als Grundlage für die koloniale Logistik mörderischer Eroberungen. So wurden die sieben Kreuzzüge zwischen 1096 und 1272 maßgeblich durch die Flotten Genuas und Venedigs ins Werk gesetzt, wobei Venedig allein für den vierten Kreuzzug von 1202 bis 1204 über 250 Schiffe bereitstellte. Ähnliches gilt für die Sklaverei. Für den Transport von zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern nach Amerika entstand eine grausame Verschleppungsindustrie, in deren Zusammenhang Historiker mittlerweile rund 28 000 Schiffspassagen, geschätzt ein Drittel aller Fahrten, rekonstruieren können.
Verdüstert sich der freie Blick aufs Meer vor dem Hintergrund seiner tödlichen Kraft, stellte die Philosophiegeschichte indes eine Art intellektuellen Abwehrmechanismus dafür bereit. Zumindest was die naturgewaltliche, nicht-menschengemachte Dimension des maritimen Zerstörungspotenzials anbelangt. Und dieser heißt: Erhabenheit. Das Konzept der Erhabenheit, das von so unterschiedlichen Denkern wie Edmund Burke, Immanuel Kant oder Friedrich Schiller theoretisiert wurde, meint im Kern: Der Anblick des dunklen, machtvollen Unendlichen, dessen, wie Kant sagt, „was schlechthin groß ist“, also Berge, Vulkane oder eben Ozeane, mag uns zunächst zwar in seiner lebensbedrohlichen Gewaltigkeit einschüchtern, doch gebe gerade dies dem Menschen die Möglichkeit, sich als autonomes Vernunftwesen zu erkennen.
Denn für Kant liegt die Erhabenheit nicht wesenhaft in der Natur selbst. „So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben genannt werden“, schreibt der Philosoph in seiner Kritik der Urteilskraft. „Sein Anblick ist grässlich; und man muss das Gemüt schon mit mancherlei Ideen angefüllt haben, wenn es durch eine solche Anschauung zu einem Gefühl gestimmt werden soll, welches selbst erhaben ist.“ Dies gelingt für Kant durch eine ästhetische Erziehung, die einen in die innere Verfassung versetzt, welche die grässliche Ohnmacht gegenüber den Weiten des Ozeans in eine Art moralisches Gefühl transformieren kann. Im Angesicht der sinnlichen Unterlegenheit gegenüber den Sturmwellen könne man sodann jene geistige Überlegenheit spüren, durch die sich der Mensch dank Vernunft und Technik von der Natur zu emanzipieren vermag. Erhabenheit, so würde man heute vielleicht sagen, ist also eine vitalitätssteigernde Angstlust.
Vitalität wird indes oft auch dem dritten maritimen Grundgefühl zugerechnet: dem buchstäblich abenteuerlichen Willen zum Wissen. Dieser zeigt sich nicht nur in den „Entdeckungen“ von Kolumbus und Co, deren integrale Einbettung in mörderische Kolonialprojekte bis heute ja oft nur beiläufig erwähnt wird, sondern wird auch deutlich, wenn man ins Kino geht oder einen Blick in Kinderzimmer wirft. Dort wird man heute nämlich kaum noch an jener meist klischeehaft überzeichneten Piratenwelt vorbeikommen, die mittlerweile als massenkompatible Chiffre für Abenteuerlichkeit und Glücksrittertum firmiert. Aber abgesehen davon, dass die mit der gleichermaßen brutalen wie buchstäblich erbärmlichen Realität der Freibeuterei, wie man sie bis heute vor den Küsten Somalias findet, kaum etwas zu tun haben, war die Piraterie historisch weniger ein Gegenentwurf als vielmehr systematischer Bestandteil machtpolitischer wie marktwirtschaftlicher Rationalisierungprozesse. Denn die Geschichte des Meeres mag zwar auch immer wieder die Geschichte anarchischer Leidenschaften gewesen sein, aber sie war vor allem eine des rechnenden Kalküls.
Transozeanische Imperien
Empfahl Platon noch in seinen Nomoi Städte fernab vom Meer zu bauen, da letzteres den Zustrom von fremden Geschäftemachern begünstige, die die sittliche Ordnung zerrütten würden, wurden Häfen nichtsdestotrotz zum unschlagbaren Standortvorteil. Hatten spätestens die römischen Flotten das mare nostrum zur einem maritimen Marktplatz gemacht, waren die ökonomischen Vorteile des grenzübergreifenden Austauschs nun mehr als offensichtlich. Wobei das nicht hieß, dass dieser immer friedlich blieb. Im Gegenteil. Skrupellose Freibeuter setzten bereits dem römischen Reich derart zu, dass es durch das Ausbleiben von Getreidelieferungen zu Aufständen kam. Daraufhin erließ der römische Senat 67 v. Chr. eine Art antike Antiterrorgesetzgebung, die den General Pompeius mit quasi-diktatorischen Vollmachten ausstattete, sodass dieser mit über 500 Schiffen erfolgreich gegen die Seeräuber ins flüssige Feld zog.
Im Laufe der Geschichte fanden Staaten jedoch oft einen weitaus effektiveren Umgang mit jenen Piraten, Korsaren und Bukanieren, die später oft auch nur merchant adventurer genannt wurden: Sie spannten sie für die eigenen ökonomischen und militärischen Zwecke ein. Dank königlich ausgestellter Kaperbriefe, die bis ins 19. Jahrhundert verteilt wurden, entwickelte sich das Seeräubertum zu einer Art parastaatlichen Söldneragentur, die etwa maßgeblich daran beteiligt war, dass Frankreich, Großbritannien und die Niederlande in der frühen Neuzeit die spanisch-portugiesische Vorherrschaft auf den Weltmeeren brechen konnten. Solch ein lukratives Zusammenspiel von staatlichen und parastaatlichen Institutionen zwecks Eroberung von Macht und Märkten findet sich in der Moderne immer wieder: Von der Gründung der holländischen Vereenigde Oostindische Compagnie im Jahr 1602, einer der ersten Aktiengesellschaften der Welt und über Jahrhunderte ein gleichermaßen skrupelloser wie erfolgreicher Quasi-Monopolist im euro-asiatischen Handel, bis zum Einsatz von den Blackwater-Söldnern der US-Regierung im Irak-Krieg ab 2003.
Auf dem Meer offenbarten sich aber auch noch viele andere historische Entwicklungen in einer Art Brennglas. Denn der internationale Kampf um die Hoheit auf der Hochsee erforderte nicht nur eine Professionalisierung der staatlichen Bürokratie, etwa in Form der Einführung von nautischen Kartographieämtern und Ausbildungsakademien, sondern ebenso einen intensiven Wettlauf in puncto Produktivität und Innovation. Stiegen die kleinen Niederlande nicht zuletzt deshalb zur maritimen Weltmacht auf, weil sie den Schiffsbau technisch revolutionierten und vor allem in effizienten Werften standardisierten, beruhte Großbritanniens transozeanisches Imperium wiederum auch auf der Erfindung des Chronometers, das die nautischen Navigationsmöglichkeiten auf eine völlig neue Stufe hob.
Zudem existierte das, was wir seit einiger Zeit eine globalisierte Arbeitswelt nennen, auf dem Meer schon seit Jahrhunderten. Gerade in relativ bevölkerungsarmen Seefahrernationen wie Portugal oder den Niederlanden gehörte es bereits seit der Renaissance zur Normalität, dass die Schiffscrews eine multinationale Mischung bildeten. Ebenso ließ sich das, was später „Klassenkampf“ heißen sollte, in seiner Frühform besonders deutlich auf dem Meer beobachten, wenn meuternde Matrosen gegen die oft diktatorische Allgewalt der Kapitäne und deren alltägliche Menschenschinderei revoltierten. Angesichts dieser historisch treibenden Kraft der See scheint es kaum verwunderlich, dass Georg Friedrich Wilhelm Hegel, der in seinen geschichtsphilosophischen Vorlesungen immer wieder auf das Meer zu sprechen kam, in diesem ein privilegiertes Medium des Weltgeists erkannte. Denn das Meer begründe eine „eigene Lebensweise“, die dem Menschen eine Vorstellung des Unendlichen gebe, welche ihn wiederum ermutige „hinaus über das Beschränkte“ zu gehen. Das Meer erwecke somit „den Mut; es lädt den Menschen zur Eroberung, zum Raub, aber auch zum Gewinn und Erwerb.“
Medium der Selbstfindung
Die maritimen Eroberungszüge führten historisch jedoch nicht nur zur kapitalistischen Vermessung der Welt, sondern auch zur Kartographierung der menschlichen Seele. Denn spätestens ab der Romantik stand das Meer nicht mehr nur für die Erschließung der äußeren, sondern auch der inneren Welt. Im kollektiven Bewusstsein avancierte es zu einer psychologischen Landschaft, die, verstärkt durch die Entstehung von Seebädern und Badekultur, als Gegenpol zur urbanen Geschäftigkeit fungierte. Ob in der Malerei, die, wie etwa bei Max Beckmann oder Emil Nolde, in unzähligen Strandlandschaften eine seelische Ruhe entdeckte, in der Psychoanalyse, die von „ozeanischen Gefühlen“ sprach, oder in der Literatur, die in den großen Meeresromanen wie Hermann Melvilles Moby Dick oder Ernest Hemingways Der alte Mann und das Meer zwar vordergründig vom abenteuerlichen Wettstreit mit der Natur erzählt, tatsächlich aber eher einen Kampf des Menschen mit sich selbst inszeniert: Das Meer wurde zum Medium menschlicher Selbstfindung.
Vor diesem Hintergrund wird eine andere, immer evidenter werdende Folge der ökonomischen Eroberung der Ozeane jedoch nur noch schizophrener: ihre Zerstörung. Denn die systematische Vergiftung und Verschmutzung der Meere durch den Menschen, die ihren exemplarischen Ausdruck zuletzt etwa darin fand, dass eine Tauchmission im pazifischen Marianengraben, dem mit elf Kilometern tiefsten Punkt der Erde, auch auf Plastikmüll stieß, stellt das Meer vor eine buchstäbliche Existenzkrise. Droht die See im Angesicht von Klimawandel, Artensterben und ökologischem Raubbau zu einer Art fauligen Industriebrache zu degenerieren, gibt es von der maritimen Schönheit vielleicht bald nur noch verblasste Fotos. Das mag übrigens auch Jean-Luc Godard geahnt haben. Kurz bevor in Le Mépris der abschließende Schwenk aufs Mittelmeer erfolgt, sieht man nämlich, dass vor diesem maritimen Hintergrund ein Film im Film gedreht wird. Die glitzernden Wassermassen, so die intrikate Botschaft, offenbaren sich dem Zuschauer schon hier als trügerisches Abbild.
Diese drohende Verwüstung des Meeres wäre nicht zuletzt auch deshalb so dramatisch, weil es stets zum tröstlichen Versprechen der See gehörte, dass sie uns in ihrer ambivalenten Pracht auch dann noch erscheint, wenn sonst nichts mehr bleibt. Oder wie es der Philosoph Albert Camus in seinem Essay Das Meer (Bordtagebuch) mit dem nötigen Pathos ausdrückte: „Müsste ich sterben, umringt von kalten Bergen, ungekannt von allen, von den meinen verstoßen, würde das Meer im letzten Augenblick meine Zelle füllen und mich emporheben über mich selber und würde mir helfen, ohne Hass zu sterben.“ •
Weitere Artikel
Albrecht Vorster: „Der Schlaf eint alle lernfähigen Lebewesen“
Gut ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Doch wozu eigentlich? Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir nicht bei uns sind? Der Schlafforscher Albrecht Vorster über mentale Aufräumarbeit, schlummernde Meeresschnecken und menschliche Biorhythmen.

Gibt es nicht längst eine globale NATO?
Die USA basteln an einem allozeanischen Bündnis gegen China und setzen damit eine alte geopolitische Tradition fort. Seit Jahrhunderten versuchen London und später Washington, die stärkste Kontinentalmacht zurückzudrängen – um die Freiheit der Meere und Märkte zu verteidigen.

Moby - Der Klangvolle
Sein wirklicher Name klingt auch nicht schlecht: Richard Melville Hall. Der Nachname „Melville“ führt zurück auf Mobys Ururgroßonkel, den Schriftsteller Hermann Melville, Autor des Klassikers „Moby Dick“. Doch anstatt sich als Walfänger im Rauschen des Meeres zu verlieren, kreiert Moby als Musiker lieber seine eigenen synthetischen Klangwelten. Ein Philosoph der Töne, immer auf der Suche nach dem perfekten Sound, so auch in seinem neuen Werk „Innocents“
Die Strömung und wir
Jüngst fanden Forscher heraus, dass sich die Geschwindigkeit des Golfstroms in den letzten 40 Jahre um 4 % reduziert hat. Bereits 1800 machte der Historiker Jules Michelet auf die Wichtigkeit von Meeresströmungen für das globale Klima aufmerksam.
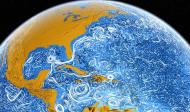
Die Sache mit den Spaghetti
Heute, am 25.10., ist Weltnudeltag. Zu diesem Anlass tischen wir Ihnen Wolfram Eilenbergers Kolumne zur wahrscheinlich beliebtesten Pasta auf: Spaghetti. Was diese philosophisch interessant macht? In ihr spiegelt sich nicht nur die menschliche Existenz – sie steht überdies für den einzig wahren Humanismus.

Kleine Menschen, große Fragen
Oft stellen Kinder nicht nur sehr gute Fragen, sondern haben auch besonders geistreiche Antworten. In unserer Rubrik Phil.Kids widmen sich kleine Menschen regelmäßig den ganz großen Rätseln des Seins wie: Warum fahren Erwachsene in den Urlaub? Wann hat man etwas verstanden? Und sollte man immer machen, was andere einem sagen?

Kann uns die Liebe retten?
Der Markt der Gefühle hat Konjunktur. Allen voran das Geschäft des Onlinedatings, welches hierzulande mit 8,4 Millionen aktiven Nutzern jährlich über 200 Millionen Euro umsetzt. Doch nicht nur dort. Schaltet man etwa das Radio ein, ist es kein Zufall, direkt auf einen Lovesong zu stoßen. Von den 2016 in Deutschland zehn meistverkauften Hits handeln sechs von der Liebe. Ähnlich verhält es sich in den sozialen Netzwerken. Obwohl diese mittlerweile als Echokammern des Hasses gelten, strotzt beispielsweise Facebook nur so von „Visual-Statement“-Seiten, deren meist liebeskitschige Spruchbildchen Hunderttausende Male geteilt werden. Allein die Seite „Liebes Sprüche“, von der es zig Ableger gibt, hat dort über 200 000 Follower. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich eine Liebesbotschaft auch ins Zimmer stellen. „All you need is love“, den Titel des berühmten Beatles-Songs, gibt es beispielsweise auch als Poster, Wandtattoo, Küchenschild oder Kaffeetasse zu kaufen.
Unheimliche Umarmung
Das „Hugshirt“ verspricht das Gefühl einer Umarmung, ohne dabei tatsächlich berührt zu werden. Dies mag in Zeiten der Pandemie verführerisch klingen, könnte aber auch eine Urangst in uns befeuern.
