Philosophie der zweiten Welle
Lange wurde vor der zweiten Welle der Pandemie gewarnt, nun ist sie da. Erneut werden die Maßnahmen verschärft und dringliche Warnungen ausgesprochen. Unweigerlich fühlt man sich da an das Frühjahr erinnert und stellt sich die Frage: Alles nochmal durchmachen? Wie geht man am besten mit solch einer Wiederholung um? Und liegt in der Wiederkehr des Gleichen auch eine Chance? Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard können Hinweise geben.
Wer einen Blick in die Philosophiegeschichte wirft, findet besonders im 19. Jahrhundert zahlreiche Geistesgrößen, die sich mit dem Thema Wiederholung beschäftigt haben. Dabei sehen einige im Prinzip der Wiederkehr die Annahme bestätigt, dass das Leben nicht nur immer schlecht – weil mit dem Tod – endet, sondern auch schon davor, aus nichts als Hoffnungslosigkeit besteht. So mag sich subjektiv zwar der Eindruck einstellen, dass sich Dinge zum Besseren wenden, indem wir neue Menschen kennenlernen und neue Interessensgebiete aufschließen. Tatsächlich jedoch, so die Position, greifen wir unweigerlich auf alte Routinen zurück und verfallen in bekannte Muster, was wirklich Neues im Keim erstickt. Wie oft haben Menschen beispielsweise schon jenes Glück in einer zweiten Ehe gesucht, das sie in der ersten nicht finden konnten, um ihre Suche in einer dritten fortzusetzen? Wie viele Menschen gaben sich schon der Illusion hin, sich im neuen Job nicht mehr zu überarbeiten, dem Burnout schlussendlich allerdings nicht entkamen. Und von Neujahrsvorsätzen wollen wir gar nicht erst reden.
Der 1788 geborene Arthur Schopenhauer, der vermutlich zu den pessimistischsten Denkern seiner Zeit gehörte, könnte gewissermaßen ein Hausheiliger jener Mahner sein, die bereits seit Monaten vor einer zweiten Welle warnen. „Weil nämlich das Wesen aller Dinge“, schreibt Schopenhauer in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung „im Grunde Eines ist; so ist alle Erkenntniß desselben nothwendig tautologisch: ist es nun ein Mal gefaßt, (…) was bliebe ihnen übrig, als bloße Wiederholung und deren Langeweile, eine endlose Zeit hindurch?“ Und selbst wenn wir nicht auf das Wesen der Dinge zielen, sondern uns lediglich etwas Lustvolles wünschen, entkommen wir Schopenhauer zufolge dem Leiden nicht, weil uns die Vorstellung ängstigt, dass wir den Gegenstand unseres Verlangens nicht bekommen könnten. Und selbst wenn wir diesem habhaft werden, sobald unser Wunsch erfüllt ist, fallen wir in Langeweile zurück. Das „Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile, welche Beide in der That dessen letzte Bestandtheile sind“, schreibt Schopenhauer. So ist die Wiederholung das Los aller, einschließlich derer, die glauben, sie könnten ihr entkommen.
Könnte man aber nicht auch fragen, ob uns die Erfahrung der ersten Welle einen Wissensvorsprung für die zweite gibt? Im Frühjahr waren wir auf der Hut, ängstlich, handlungsbereit und besorgt. Diese Zeit hat einige von uns aus Müdigkeit zu Fatalisten, andere aufgrund von Desillusionierung zu Zynikern gemacht. Erinnern wir uns deshalb kurz an das berühmte Zitat Karl Marx’ aus Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte aus dem Jahr 1852: „Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ Diese Wiederholung jedoch ist auch charakteristisch für die Komödie – die ihrer Form gemäß zum Lachen bringen und den Spieltrieb anregen will.
Mit Angst leben?
Andere Philosophen des 19. Jahrhunderts schlugen vor, die Wiederholung aus einem anderen, positiveren Blickwinkel zu betrachten. Für sie ist die Wiederholung nicht die Manifestation der Absurdität unserer Existenz oder entfremdende Routine. So fasste etwa Friedrich Nietzsche am Ende des Jahres 1881 den Beschluss, der Welt nicht mehr mit Ablehnung begegnen zu wollen, sondern sein Schicksal anzunehmen und es zu lieben: „Amor fati, liebe dein Schicksal!“, verkündete er. Die Ereignisse in der Welt für das eigene Unglück verantwortlich zu machen, so Nietzsche, würde nämlich nur bedeuten, sich den Leugnern und Verbitterten anzuschließen, die niemals glücklich sein werden, da sich in der Welt immerzu Schreckliches ereignen wird. Wer sich über das beschwert, was einem zustößt, schließt sich laut Nietzsche der nörgelnden Masse an, die sich in ihrem Lamento gefällt, anstatt den eigenen Willen zur Macht anzuerkennen und auszuleben.
Aber kann diese Vorläuferform des positive thinking wirklich die Lösung sein? Müssen wir die Angst vor Ansteckung lieben lernen? In dieser Welle und vielleicht noch in vielen kommenden? Für Nietzsche lag im Gedanken dieser ewigen Wiederkunft keine Resignation, wie sich am gleichnamigen Gedankenexperiment in seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft aus dem Jahr 1882 zeigt: „Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: ‚Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in derselben Reihe und Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!‘ – Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: ‚du bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres!‘ Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen; die Frage bei Allem und Jedem ‚willst du dies noch einmal und noch unzählige Male?‘ würde als das grösste Schwergewicht auf deinem Handeln liegen! Oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?“ Nietzsche fordert uns also dazu auf, die Idee einer ewigen Wiederkunft des Gleichen als etwas Positives anzunehmen und es im Fall des Gelingens als ein Zeichen dafür zu sehen, das man ein gelungenes Leben führt.
Erinnerung als Therapie
Auf die aktuelle Situation bezogen, ließe sich also fragen: Ist Amor Covid die Lösung? Warum nicht, wenn die Alternative in Angstzuständen, Depressionen und Ungewissheit besteht? Doch gilt es auch zu sehen, dass der von Nietzsche vorgeschlagene Umgang mit Wiederholung mit großer innerlicher Arbeit verbunden ist. Leider sind wir allerdings nicht alle zu derartig übermenschlichen Leistungen im Stande. Überdies kann die positive Annahme der Wiederholung eines Unglücks auch zu Passivität führen.
Führen wir uns also noch eine weitere Position zur Wiederholung vor Augen. Mit seinem Werk Die Wiederholung widmete der dänische Philosoph Søren Kierkegaard 1843 dem Thema ein ganzes Buch. Dabei stellte er die beiden Bedeutungsebenen in den Mittelpunkt seiner Untersuchung, die das dänische Wort für Wiederholung, „Gjentagelse“, in sich trägt. Denn Gjentagelse meint sowohl die Wiederaufnahme von etwas, das man vor einiger Zeit hat fallen lassen, wie auch die erneute Ausführung einer bereits bekannten Tätigkeit. Zudem trägt Kierkegaards Buch stark autobiografische Züge, da er sich kurz vor der Hochzeit von seiner Verlobten Regine Olsen trennte und nach einer Begegnung in der Kirche über eine „Wiederaufnahme und Erneuerung“ der Beziehung nachdachte.
Um herauszufinden, ob dieses Projekt gelingen kann, zog er nach Berlin, wo er zuvor bereits einige Zeit verbracht hatte und bewohnte dort sogar erneut sein altes Zimmer. Jedoch stellte er schnell fest, dass eine Wiederholung auf diese Weise nicht möglich ist, weil sich nichts exakt wie bereits geschehen wiederholt. Kierkegaard sieht ein: Wenn man versucht, vergangenes Glück wiederherzustellen, indem man an denselben Orten identische Bedingungen herstellen will, führt dies unweigerlich zum Scheitern. Schließlich gibt es immer etwas, dass einen daran erinnert, dass sich alles verändert hat – mitunter ist man selbst ein ganz anderer geworden. Kierkegaards Verständnis von Wiederholung erschöpft sich also nicht in einer bloß repetitiven Abfolge bereits einmal durchgeführter Handlungen, sondern zielt darauf ab, sich bereits bekannte Dinge neu anzueignen oder gänzlich Neues zu erschaffen. Ihm ist daran gelegen, durch seine Philosophie eine Art existenzielle Therapie für lebensweltliche Probleme anzubieten.
In Kierkegaards Interpretation verstehen wir damit Ereignisse beim ersten Mal ohnehin nie vollständig, weil wir gänzlich damit beschäftigt sind, erstaunt, entrückt oder gar verängstigt zu sein. Man denke nur an die erste Nacht mit einem Menschen, der uns fasziniert, in der man nichts kontrolliert, nichts vergleicht und nichts versteht. Der Moment erschöpft sich ganz in Eindrücken, die keine Beispiele kennen. Deshalb ist die zweite Nacht die eigentlich entscheidende: Wir kennen den anderen bereits ein bisschen und sind so nicht mehr auf einer Expedition mit ungewissem Ausgang, sondern haben es, technisch gesprochen, mit einer bewussten Sammlung von Eindrücken zu tun, die in Relation zu anderen gebracht werden können. Liebe auf den ersten Blick hielt Kierkegaard demnach für eine Unmöglichkeit. Erst auf den zweiten Blick kann ein so festes Band wie die Liebe geknüpft werden.
Deshalb misst Kierkegaard auch der Erinnerung einen hohen Stellenwert bei, da wir durch diese bewusst wiederholen, was uns beim ersten Mal ohne Möglichkeit der Reflexion zugestoßen ist. In der Entscheidung dessen, an was wir uns erinnern wollen, was wir also willentlich ein zweites Mal aufnehmen, zeigt sich, womit wir es wirklich ernst meinen. Welche Dinge sind derart wichtig, dass sich die Erinnerung und damit ein zweites Erleben lohnt? Diese Frage nimmt in der Philosophie Kierkegaards eine wichtige Rolle ein. Im Gegensatz zu Schopenhauer also, der im Leben ein lustloses Pendeln zwischen Schmerz und Langeweile erkennen will und Nietzsche, der allem, was geschieht ein freudiges „Ja“ entgegenwirft, um die Unschuld des Werdens wiederzuentdecken, will Kierkegaard entscheiden, was wiederholt werden soll, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Sollten wir im Sinne Kierkegaards also gar froh über eine zweite Welle sein? Das wäre sicher zu viel gesagt. Denn auch wenn sich diese zwangsläufig von der ersten unterscheiden wird, wird uns dennoch über weite Strecken blühen, was wir bereits kennen: Einschränkungen und Ungewissheit. Doch muss wie auch schon im Frühjahr nicht alles schlecht sein. Viele konnten im Zuge der ersten Welle schlechte Gewohnheiten loswerden, mehr Zeit mit innerer Einkehr verbringen oder Solidarität durch Nachbarn erfahren, von deren Existenz sie davor nicht wussten. Sogar denkbar dramatische Momente wie eine Reise ins Krankenhaus, der Verlust einer geliebten Person und die Unmöglichkeit sie entsprechend zu begleiten, waren eine Gelegenheit zu verstehen, was uns am Herzen liegt. Die Covid-Tortur hat uns aus dem alltäglichen Trott gebracht und uns mit den tatsächlich bedeutenden Fragen konfrontiert. So scheint es alles andere als absurd, sich eine Erinnerung an die erste Welle ganz im Sinne Kierkegaards als einen Lichtblick vorzustellen, der die zweite erhellen kann. Oder mit einem anderen Bild gesprochen: Weil wir um die zweite Welle ohnehin nicht herumkommen, und wir sicherstellen sollten, dass sie uns nicht erdrückt, sollten wir uns wie Surfer auf sie vorbereiten. •
Michel Eltchaninoff ist Philosoph, Journalist und stellvertretender Chefredakteur des französischen Philosophie Magazine. 2016 erschien sein Buch „In Putins Kopf“ (Tropen), 2017 „Dans la tête de Marine Le Pen“ (Actes Sud).
Weitere Artikel
Und woran zweifelst du?
Wahrscheinlich geht es Ihnen derzeit ähnlich. Fast täglich muss ich mir aufs Neue eingestehen, wie viel Falsches ich die letzten Jahre für wahr und absolut unumstößlich gehalten habe. Und wie zweifelhaft mir deshalb nun alle Annahmen geworden sind, die auf diesem Fundament aufbauten. Niemand, dessen Urteilskraft ich traute, hat den Brexit ernsthaft für möglich gehalten. Niemand die Wahl Donald Trumps. Und hätte mir ein kundiger Freund vor nur zwei Jahren prophezeit, dass im Frühjahr 2017 der Fortbestand der USA als liberaler Rechtsstaat ebenso ernsthaft infrage steht wie die Zukunft der EU, ich hätte ihn als unheilbaren Apokalyptiker belächelt. Auf die Frage, woran ich derzeit am meisten zweifle, vermag ich deshalb nur eine ehrliche Antwort zu geben: Ich zweifle an mir selbst. Nicht zuletzt frage ich mich, ob die wundersam stabile Weltordnung, in der ich als Westeuropäer meine gesamte bisherige Lebenszeit verbringen durfte, sich nicht nur als kurze Traumepisode erweisen könnte, aus der wir nun alle gemeinsam schmerzhaft erwachen müssen. Es sind Zweifel, die mich tief verunsichern. Nur allzu gern wüsste ich sie durch eindeutige Fakten, klärende Methoden oder auch nur glaubhafte Verheißungen zu befrieden.
Das Ideal der Intensität
Man kennt es aus Filmen und Romanen: Die Frage nach dem Lohn des Lebens stellt sich typischerweise erst im Rückblick. Als Abrechnung mit sich selbst und der Welt. Wenn das Dasein noch mal vor dem inneren Auge vorbeifliegt, wird biografisch Bilanz gezogen: Hat es sich gelohnt? War es das wert? Würde man alles wieder so machen? Dabei läge es viel näher, die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, nicht so lange aufzuschieben, bis es zu spät ist, sondern sie zum Gradmesser von Gegenwart und Zukunft zu machen. Zum einen, weil sie so gegen spätere Reuegefühle imprägniert. Wer sich darüber im Klaren ist, was das Leben wirklich lebenswert macht, wird gegenüber dem melancholischen Konjunktiv des „Hätte ich mal …“ zumindest ein wenig wetterfest. Zum anderen ist die Frage als solche viel dringlicher geworden: In dem Maße, wie traditionelle Bindungssysteme an Einfluss verloren haben, also etwa die Bedeutung von Religion, Nation und Familie geschwunden ist, hat sich der persönliche Sinndruck enorm erhöht. Wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen, ja, die Mühen des Lebens überhaupt auf sich zu nehmen? Was genau ist es, das einem auch in schwierigen Zeiten Halt verleiht? Und am Ende wirklich zählt – gezählt haben wird?
Männer und Frauen: Wollen wir dasselbe?
Manche Fragen sind nicht dazu da, ausgesprochen zu werden. Sie stehen im Raum, bestimmen die Atmosphäre zwischen zwei Menschen, die nach einer Antwort suchen. Und selbst wenn die Zeichen richtig gedeutet werden, wer sagt, dass beide wirklich und wahrhaftig dasselbe wollen? Wie wäre dieses Selbe zu bestimmen aus der Perspektive verschiedener Geschlechter? So zeigt sich in der gegenwärtigen Debatte um #metoo eindrücklich, wie immens das Maß der Verkennung, der Missdeutungen und Machtgefälle ist – bis hin zu handfester Gewalt. Oder haben wir nur noch nicht begriffen, wie Differenz in ein wechselseitiges Wollen zu verwandeln wäre? Das folgende Dossier zeigt drei Möglichkeiten für ein geglücktes Geschlechterverhältnis auf. I: Regeln. II: Ermächtigen. III: Verstehen. Geben wir Mann und Frau noch eine Chance!
Søren Kierkegaard und die Freiheit
Es gibt keine Freiheit ohne Angst, und genau hierin liegt die Möglichkeit des Menschen, behauptet der dänische Philosoph Søren Kierkegaard in seiner Schrift Der Begriff Angst aus dem Jahr 1844. Sie verstehen kein Wort? Wir helfen Ihnen!

Perfekte Matches, leere Begegnungen
Die Beliebtheit von Dating-Apps lässt stark nach. Woran liegt das? Gernot Böhmes Überlegungen zur Bedeutung der „Atmosphäre“ geben Hinweise.

Schopenhauer und die Hoffnung
Für Christen ist die Hoffnung eine Tugend. Arthur Schopenhauer hingegen verstand sie als „Verwechslung des Wunsches einer Begebenheit mit ihrer Wahrscheinlichkeit“. Wie ist das zu verstehen? Eine Interpretationshilfe.
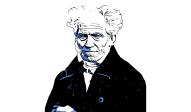
Gibt es einen guten Tod?
Es ist stockdunkel und absolut still. Ich liege auf dem Rücken, meine gefalteten Hände ruhen auf meinem Bauch. Wie zum Beweis, dass ich noch lebe, bewege ich den kleinen Finger, hebe ein Knie, zwinkere mit den Augen. Und doch werde ich, daran besteht nicht der geringste Zweifel, eines Tages sterben und wahrscheinlich genauso, wie ich jetzt daliege, in einem Sarg ruhen … So oder so ähnlich war das damals, als ich ungefähr zehn Jahre alt war und mir vor dem Einschlafen mit einem Kribbeln in der Magengegend vorzustellen versuchte, tot zu sein. Heute, drei Jahrzehnte später, ist der Gedanke an das Ende für mich weitaus dringlicher. Ich bin 40 Jahre alt, ungefähr die Hälfte meines Lebens ist vorbei. In diesem Jahr starben zwei Menschen aus meinem nahen Umfeld, die kaum älter waren als ich. Wie aber soll ich mit dem Faktum der Endlichkeit umgehen? Wie existieren, wenn alles auf den Tod hinausläuft und wir nicht wissen können, wann er uns ereilt? Ist eine Versöhnung mit dem unausweichlichen Ende überhaupt möglich – und wenn ja, auf welche Weise?

Étienne Klein: „Wenn Einstein heute unter uns wäre, würde er die gleichen Dinge sagen wie 1933“
Der Physiker Étienne Klein erinnert an Albert Einsteins Worte aus dem Jahr 1933, als er gegen einen Pazifismus Stellung bezog, der seiner Meinung nach übertrieben und angesichts des Ernstes der Umstände unangemessen war.
