ChatGPT – und jetzt?
Für den Philosophen Pierre Cassou-Noguès dienen die Verheißungen um das computergestützte Sprachsystem ChatGPT vor allem dazu, Investoren anzuziehen. Die bedeutenden sozialen und politischen Herausforderungen werden aber an uns hängen bleiben.
ChatGPT verspricht zum x-ten Mal, dass wir in ein Zeitalter eintreten, in dem die künstliche Intelligenz ihren Charakter ändert und die menschlichen Fähigkeiten endgültig übersteigt. Seit dem verblüffenden Triumph des Supercomputers Deep Blue – der den Weltmeister Garry Kasparow im Schach besiegte – oder in jüngerer Zeit denjenigen von AlphaGo, verkauft uns das Silicon Valley diesen Mythos der Singularität, die Prophezeiung des Wendepunkts in eine neue, von Maschinen beherrschte Welt. Dieser Diskurs ist eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Medien und der Investoren auf sich zu ziehen. Es ist eine wirtschaftliche Strategie und wir müssen vorsichtig sein.
Die richtige und die falsche Handschrift
Was macht ChatGPT eigentlich? Es produziert Wortfolgen. Es handelt sich um einen Algorithmus, der die wahrscheinlichste Folge eines Textes berechnet. Er kann philosophische Aufsätze, Artikel, Romane oder sogar ein Kochrezept produzieren. Konversationelle Computerprogramme gibt es schon sehr lange. Bereits 1963 entwickelte der Informatiker Joseph Weizenbaum das Programm ELIZA, das ein Gespräch in Gang hält, indem es auf ein bestimmtes Wort aus der zuletzt an sie gerichteten Nachricht reagiert und skriptbasiert darauf antwortet. Das ging so weit, dass Weizenbaums Sekretärin das Programm zur Psychoanalyse nutzte. Der Künstler Grégory Chatonsky setzte ein Programm ein, um Romane zu schreiben. ChatGPT hingegen scheint noch genauer zu sein. Die Aufsätze sehen relativ glaubwürdig aus, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir ihre Relevanz beurteilen können. Auch wenn die Datenbank riesig ist und die englische Wikipedia nur 0,6 % ihres Speichers ausmacht, bleibt abzuwarten, ob die Antworten nicht irgendwann standardisiert werden.
Und was könnte ein solches Programm konkret ändern? Es ist durchaus vorstellbar, dass eine Maschine am Ende hervorragende Aufsätze produziert. Das wird Schüler nicht davon befreien, Aufsätze zu schreiben: Es geht um die Schulung des Denkens, nicht um die formale Übung als solche. Darüber hinaus könnte man sich vorstellen, dass diese künstliche Intelligenz recht gefällige Kriminalromane produziert. Aber das würde uns nicht den Wunsch und die Möglichkeit nehmen, zu schreiben. Das Problem der Literatur ist etwas anderes; es ist TikTok, es sind die Bildschirme, die uns in einer kurzen, hypnotischen Zeitlichkeit verankern und uns unfähig machen, uns auf lange Texte zu konzentrieren.
Befreiung von entfremdenden Aufgaben?
Es wird immer offensichtlicher, dass diese KI-Anwendungen eine Reihe von Berufsfeldern bedrohen können, z. B. eine spezifische Form des Journalismus, bei dem das Schreiben eines Artikels darin besteht, bestimmte Informationen in eine klare und pädagogische Form zu bringen. Ich denke dabei an Finanzartikel oder einfache Sportberichte. Man könnte sich jedoch fragen, ob dies wirklich ein Problem darstellt. Schließlich gibt es in den Supermärkten immer weniger Kassierer, weil es immer mehr automatische Kassen gibt.
Man könnte sogar meinen, dass die Automatisierung eine gute Sache ist. Schließlich ist eine Maschine, wenn sie einen Menschen bei einer bestimmten Aufgabe ersetzen kann, mechanisch und befreit gerade das, was menschlich in uns ist. Dann muss nur noch die Zeit, die dadurch frei wird, gerecht verteilt werden, d. h. der Mensch, der durch eine Maschine ersetzt wird, kann ohne diese Arbeit ein würdiges Leben führen, um sich anderen Dingen zu widmen, die vielleicht völlig nutzlos und unproduktiv sind: Dichten, Mathematik oder Träumen.
Freie Bahn für Fake News?
Abgesehen davon, dass die Mechanisierung derzeit keine gerechte Verteilung von Zeit und Wohlstand bewirkt (ganz im Gegenteil), ist sie nicht in allen Berufen hinnehmbar. Während ein Journalist Informationen produziert, produziert eine künstliche Intelligenz „Inhalte“ und schert sich nicht um die Wahrheit. ChatGPT klebt Wörter auf Basis einer Wahrscheinlichkeitslogik aneinander. Jeder kann sehr schnell eine umfangreiche Zahl glaubwürdiger Artikel darüber generieren, dass Impfungen unwirksam sind oder dass die Erde flach ist.
Dass eine Maschine einen Bericht über eine Etappe der Tour de France erstellen kann, ist an sich nichts Schlechtes. Es wird die Sportzeitungen vielleicht dazu anregen, wirklich lesenswerte und besondere Berichte zu veröffentlichen, wie sie zu ihrer Zeit von Antoine Blondin oder Dino Buzzati, insbesondere über den Giro d’Italia 1949 vorgelegt wurden. Aber der massive Einsatz solcher Programme zur industriellen Produktion von Fake News birgt die Gefahr, dass die Realität in einer digitalen Welt, die zunehmend von trügerischen Vorspiegelungen durchzogen ist, ertränkt wird.
In letzter Instanz müssen wir bedenken, dass Energie und seltene Erden immer teurer werden. Es ist möglich, dass diese Allgegenwart der Bildschirme, dieser universelle Zugang zu den ausgefeiltesten Techniken, dass all das letztlich ziemlich kurzlebig ist. Die Dystopie besteht vielleicht nicht darin, dass den Menschen ihre Aufgaben weggenommen werden, sondern dass die Maschinen nur einigen wenigen zugänglich sein werden – Monopolen, die sie für ihren Einfluss oder ihre Propaganda nutzen werden. •
Weitere Artikel
Pierre Zaoui: „Man muss seinem Begehren treu sein“
Geglückte Veränderung hieß für den niederländischen Denker Baruch de Spinoza (1632–1677) nicht, sich neu zu erfinden. Ganz im Gegenteil forderte er dazu auf, „in seinem Sein zu beharren“. Der Spinoza-Experte Pierre Zaoui erklärt, was damit gemeint ist.

Smarte Technologie, dumme Leser?
Das textgenerierende KI-System ChatGPT scheint Roland Barthes’ These vom „Tod des Autors“ zu bestätigen. Wo aber bleibt die Geburt souveräner Leser? Führt ChatGPT nicht zu getäuschten Lesern? Die Antwort, sagt Philipp Schönthaler, liegt auf der Textebene selbst.

Und woran zweifelst du?
Wahrscheinlich geht es Ihnen derzeit ähnlich. Fast täglich muss ich mir aufs Neue eingestehen, wie viel Falsches ich die letzten Jahre für wahr und absolut unumstößlich gehalten habe. Und wie zweifelhaft mir deshalb nun alle Annahmen geworden sind, die auf diesem Fundament aufbauten. Niemand, dessen Urteilskraft ich traute, hat den Brexit ernsthaft für möglich gehalten. Niemand die Wahl Donald Trumps. Und hätte mir ein kundiger Freund vor nur zwei Jahren prophezeit, dass im Frühjahr 2017 der Fortbestand der USA als liberaler Rechtsstaat ebenso ernsthaft infrage steht wie die Zukunft der EU, ich hätte ihn als unheilbaren Apokalyptiker belächelt. Auf die Frage, woran ich derzeit am meisten zweifle, vermag ich deshalb nur eine ehrliche Antwort zu geben: Ich zweifle an mir selbst. Nicht zuletzt frage ich mich, ob die wundersam stabile Weltordnung, in der ich als Westeuropäer meine gesamte bisherige Lebenszeit verbringen durfte, sich nicht nur als kurze Traumepisode erweisen könnte, aus der wir nun alle gemeinsam schmerzhaft erwachen müssen. Es sind Zweifel, die mich tief verunsichern. Nur allzu gern wüsste ich sie durch eindeutige Fakten, klärende Methoden oder auch nur glaubhafte Verheißungen zu befrieden.
Warum verschicken wir kitschige Postkarten?
Vorne Kitsch, hinten Floskeln. Gerade jetzt verschicken wieder Tausende Menschen Postkarten an die Daheimgebliebenen. Doch warum eigentlich? Harry Frankfurt, Pierre Bourdieu und Jacques Derrida geben Antworten.

Was ist die „unsichtbare Hand“ von Adam Smith?
Der Ausdruck „unsichtbare Hand“ stammt aus dem Denken von Adam Smith, einem bedeutenden Vertreter der schottischen Aufklärung, und ist ein zentrales Konzept des Wirtschaftsliberalismus: Er bezeichnet die Fähigkeit des Marktes, sich selbst zu regulieren. Aber hatte dieser Ausdruck für seinen Urheber nur eine wirtschaftliche Bedeutung?
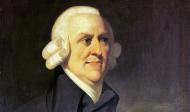
Rachel Dolezal - White African American
Bis vor wenigen Wochen lehrte Rachel Dolezal Africana Studies an der Eastern Washington University. Als örtliche Vorsitzende der bedeutenden Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People kämpfte die 37-Jährige zudem gegen die Diskriminierung von Schwarzen.
Wer hat Angst vorm Fortschritt?
Peter Thiel, Star-Investor aus dem Silicon Valley, träumt von einer radikal anderen Gesellschaft durch technologischen Fortschritt. In Paris traf er sich mit dem Philosophen und konservativen Kulturkritiker Pierre Manent. Zwei Welten prallten aufeinander – und blieben sich doch nicht fremd
Ist Zufriedenheit unterschätzt?
Glück, Freude, Seligkeit. All das sind Begriffe, denen sich zahlreiche Denkerinnen und Denker zugewandt haben. Die Zufriedenheit hingegen erfuhr keine vergleichbare Aufmerksamkeit – mit einer bedeutenden Ausnahme.

Kommentare
Ich lese, es wird vermutet, dass KI voraussichtlich das Potential haben wird, ihre Entwicklung aktiv zu verbessern. Diese Beschleunigung scheint erst einmal unbegrenzt. Doch so wie KI sich von Generation zu Generation verbessert, müssten nach meiner Vorstellung möglicherweise ältere Lebensformen gezwungenermaßen Platz machen, Bescheidenheit ist wohl nur eine Möglichkeit. Im leeren All ist das vielleicht akzeptabel, auf der Erde könnte vielleicht eine Entwicklungsstufe die letzte andere verdrängende sein, da sie die selbstverdrängende exponentielle Weiterentwicklung einstellt. So zum Beispiel die Menschheit, wenn man betrachtet, wie schnell sie sich entwickelt und wie lang die potentielle Zukunft ist.