Impulse für 2025 – Ein Jahrhundert wird erwachsen
Sonderausgabe 31 - 2024/25Das 21. Jahrhundert befindet sich in einer Quarterlife Crisis. Es weiß nicht so recht, was es will und wie sein weiteres Leben aussehen soll. Seine Eltern, der glorreiche Mauerfall und die fröhlichen 1990er-Jahre, hatten noch große Pläne mit ihm: Es sollte so werden wie sie, vielleicht noch ein bisschen liberaler und gerechter. Heute zeigt sich, dass es einen anderen Charakter hat. Es kommen immer mehr dunkle Anteile zum Vorschein: Autoritäres und Kriegerisches. Der Umgang mit neuen Technologien bereitet ihm sichtlich Probleme. Und mit dem Klimawandel kommt es überhaupt nicht zurecht. Klar ist nur, dass es so nicht weitergehen kann und dass es einen neuen Lebensplan braucht.
Wie jeder, der Probleme hat, ist das Jahrhundert gut beraten, sich Hilfe zu holen – und zwar von der Philosophie. Diese hat schon vieles gesehen und kann die Schwierigkeiten daher ganz gut einordnen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Zum Beispiel, indem sie die Zeitstimmung auf einen Begriff bringt oder versucht, eine andere zu erzeugen.
Die hier versammelten Texte wollen Wege aufzeigen, wie auch unangenehme Charakterzüge in ein stimmiges Persönlichkeitsbild integriert werden können: Kann das Jahrhundert seine Rauflust vielleicht sogar für den Fortschritt nutzen? Bietet die rasante Entwicklung der Technologie nicht auch die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft? Und führt der Klimawandel eventuell zu einem neuen Selbst- und Naturverständnis, das unser Empfindungsvermögen steigert? Vielleicht gelingt dem strauchelnden Jahrhundert schon bald ein wichtiger Adoleszenzschub, aus dem es als gefestigte Persönlichkeit hervorgeht, die endlich weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen will.
Mit Texten von: Barbara Bleisch, Ingolfur Blühdorn, Thea Dorn, Cynthia Fleury, Benjamin Santos Genta, Donna Haraway, Aurelie Herbelot, Robert D. Kaplan, Christoph Möllers, Evgeny Morozov, Herfried Münkler, Meghan O’Gieblyn, Eva von Redecker, Sara Rukaj, Leander Scholz, Nikolaj Schultz, Peter Sloterdijk, Christian Stöcker und Liya Yu.

Bild: Philotheus Nisch
Das Ringen um die Ordnung
Der Liberalismus befindet sich in der Defensive. Neue Großmächte und populistische Parteien machen ihm das Leben schwer. Droht nun sein Ende? Stehen all seine Errungenschaften zur Disposition – die individuelle Freiheit, die Verfassungsinstitutionen, das Toleranzgebot? Oder wird er gestärkt aus dieser Bedrängnis hervorgehen? Schließlich waren Krisen schon immer die beste Gelegenheit für eine Frischzellenkur.
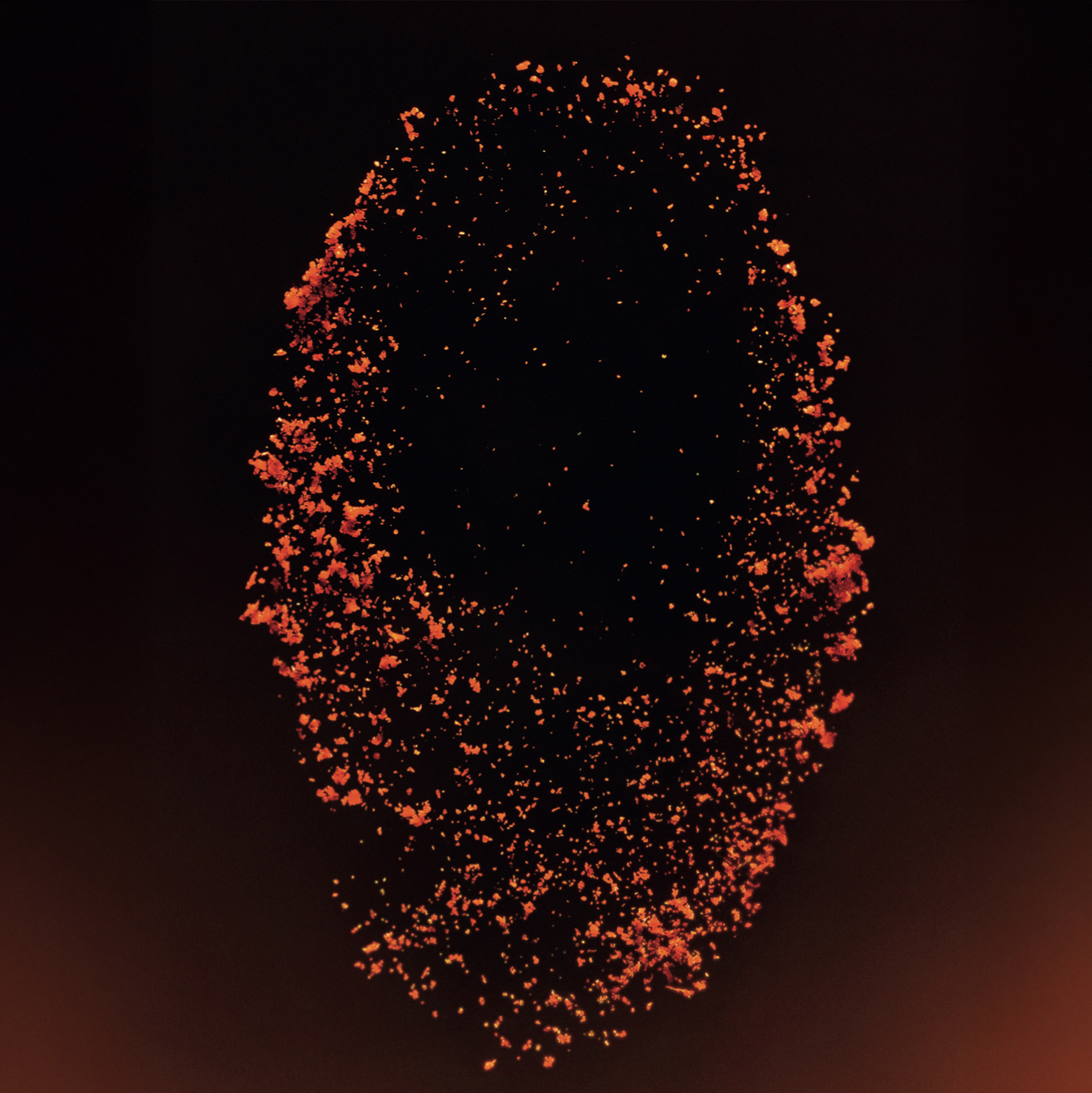
Bild: Tonje Thilesen
Wege ins Maschinenzeitalter
Seit jeher zählen Utopien und Dystopien zu den Lieblingserzählungen bürgerlicher Gesellschaften. Konzentrierten sie sich anfangs eher auf Politik und Wirtschaft, nehmen sie heute besonders die Technologie in den Blick. Die rasante Entwicklung von KI und Robotik weckt Ängste vor dem Untergang der Menschheit – aber auch Hoffnungen auf eine befreite Gesellschaft.

Bild: Tonje Thilesen
Aufwachen im Anthropozän
Die Moderne war einst angetreten, den Menschen von allen Fesseln zu befreien – etwa von Gott, Autorität und Natur. Vor allem Letztere zeigt sich damit jedoch immer weniger einverstanden. Klimawandel, Artensterben und Ressourcenschwund führen der Menschheit ihre Naturhaftigkeit vor Augen. Wie wird sie damit umgehen? Wird sie durchdrehen oder sich dem neuen Schicksal fügen – und vielleicht über Umwege das alte Emanzipationsversprechen einlösen?

Bild: Kristin Bethge
Orientierung im Denken
Wie wir denken, bestimmt unseren Umgang mit uns selbst und anderen: in Bildern oder Formeln, zweiwertig oder nonbinär, in Übereinstimmung oder in Widerspruch zu Autoritäten, ressentimentgeladen oder voller Handlungshoffnungen. Oft entziehen sich Denkweisen unserer freien Wahl. Doch da sie im Leben wurzeln, können sie eingeübt, abgelegt und umgebogen werden.
Alle Texte der Edition 2025 im Überblick
Das Ringen um die Ordnung
Die Gewalt des Fortschritts
30 Jahre lang glaubte sich ein Großteil des Westens am sicheren Ende der Geschichte angelangt. Doch nun zeigt sich: Die Geschichte geht weiter. Die sich abzeichnenden Großmachtkonflikte sind Vorboten neuer Kämpfe – aber auch des Fortschritts.

Individuelle Freiheit – ein Auslaufmodell?
Ob Coronapandemie, Klimawandel oder geopolitische Spannungen: Je massiver die Großkrisen, desto lauter wird der Ruf, den Handlungsspielraum der Einzelnen dem Wohl aller unterzuordnen. Ist individuelle Freiheit nicht mehr als egozentrische Ideologie – oder doch Kern menschlicher Autonomie? Der Philosoph Peter Sloterdijk diskutiert mit dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers auf dem Festival Philo.live!

Optimismus – eine Frage der Haltung
Im Angesicht gegenwärtiger Krisen gibt es immer weniger Anlass, positiv in die Zukunft zu blicken. Dabei ist Zuversicht wie ein Muskel – man muss sie schon ordentlich trainieren, um sie in sich zu spüren, meint Thea Dorn.

Liya Yu: „Toleranz fällt unseren Gehirnen schwer“
Das ethische Toleranzgebot stößt auf neuronale Hürden, behauptet die Politikwissenschaftlerin Liya Yu. Ein Gespräch über die evolutionäre Herausforderung liberaler Gehirne, kognitive Dehumanisierung und Neuro-Hobbesianismus.

Wie Kriege enden
Die Möglichkeiten des Friedens hängen ab von der Art des Krieges. Vier Typen gilt es zu unterscheiden. Der Ukrainekrieg ist ein besonders komplizierter Fall. Nur eine Stabilisierung des gesamten postimperialen Raums vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer kann ihn nachhaltig beenden. Ein Essay von Herfried Münkler.

Wege ins Maschinenzeitalter
Meghan O’Gieblyn: „Die amerikanische Frontier ist ein Ort der Flucht“
Amerika ist das Land der Grenzverschiebung: Früher zog es unaufhörlich nach Westen, heute in den Weltraum; zudem arbeitet es an der technologischen Singularität und am ewigen Leben. Ein Gespräch mit der Essayistin Meghan O’Gieblyn über den Mythos der Frontier, Prophetie, die sich auszahlt, und Arendts Warnung vor dem nichtmenschlichen Standpunkt.

Furcht vorm Fabelwesen
Künstliche Intelligenz könnte die Menschheit ausrotten, diese Annahme ist vor allem unter „Effektiven Altruisten“ verbreitet. So geraten die wirklichen Gefahren aus dem Blick. Ein Essay von Eva von Redecker und Aurelie Herbelot.

Eine andere KI ist möglich
Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz verblüffen, werfen aber auch die Frage auf, wozu die Technologie eigentlich dienen soll. In den 1970er-Jahren träumten Hippie-Informatiker von Maschinen, die die menschliche Intelligenz fördern und die Welt besser machen sollten. Über einen nicht beschrittenen techno-utopischen Weg.

Effective Accelerationism: Die neue Silicon-Valley-Ideologie ist dunkel und kalt
Die Tech-Szene ist auch eine Ansammlung von Ideenlaboren. Neben Versuchen, die Technologie zum Wohle der Menschheit einzusetzen, gibt es neuerdings eine Weltanschauung, die auf Beschleunigung, Entfesselung und Kampf setzt.
Aufwachen im Anthropozän
Willkommen im malthusianischen Zeitalter
Klimawandel und Überbevölkerung dürften im 21. Jahrhundert zu geopolitischem Chaos, Armut und Diktatur führen. Hatte der Ökonom und Fortschrittspessimist Thomas Robert Malthus vielleicht doch recht?

Am Abgrund einer alten Welt
Die bürgerliche Moderne ist unhaltbar geworden; das öko-emanzipatorische Projekt ebenfalls. Wer von ihren Idealen etwas retten will, muss sich dieser Unhaltbarkeit stellen. Ein Essay von Ingolfur Blühdorn.

Ein neuer Existenzialismus
Das Anthropozän, das vom Menschen gemachte Erdzeitalter, stellt ganz andere Anforderungen ans Menschsein. Wir müssen natursensibler werden, um uns in neuer Umgebung zurechtzufinden. Und wir müssen ein Gespür dafür entwickeln, dass die Koexistenz mit anderen Lebewesen unserer Existenz vorausgeht.

Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway ist eine der einflussreichsten und innovativsten Philosophinnen unserer Zeit. Ihr feministisch-ökologisches Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Evolutionstheorie, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.

Orientierung im Denken
Metaphern formen die Welt
Metaphern sind in das Gewebe der Sprache eingeflochten und prägen unser Verständnis der Realität. Was passiert, wenn wir versuchen, neue Sprachbilder zu verwenden? Ein Essay aus der Edition 2025.

Sand im Getriebe – Eine Philosophie der Störung
Was unterscheidet produktive Irritation von destruktiver Einmischung? Dieser Frage widmet sich Barbara Bleisch in der Eröffnungsrede des 26. Philosophicum Lech zum Thema „Störung“, das am Wochenende stattfand.

Der neue Identitätszwang
Judith Butler nennt alle, die am Unterschied zwischen Ei- und Samenzelle festhalten, Faschisten. Dieser asexuelle Tunnelblick schafft neue Rivalitäten – und ist ziemlich konservativ.

Cynthia Fleury: „Die Sublimierung des Ressentiments gelingt uns immer weniger“
Das Ressentiment ist eine Selbstvergiftung. Gesellschaftlich nimmt sie dramatisch zu, meint Cynthia Fleury. Was tun? Muss Heilung individuell oder kollektiv ansetzen? Die Philosophin und Psychoanalytikerin über ihr neues Buch Hier liegt Bitterkeit begraben.
