Homo als Humus: Ethische Herausforderungen der „Reerdigung“
Bei der neuen Bestattungsform werden Verstorbene kompostiert und anschließend als Erde beigesetzt. Nachhaltigkeit auch nach dem Tod geht jedoch besser, meint Kira Meyer.
„Aus der Erde sind wir gekommen, zur Erde sollen wir wieder werden. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.“ Diese liturgische Formel sprechen Geistlichen häufig bei christlichen Beerdigungen. Doch für den Moment der Beerdigung selbst trifft dieser Spruch noch gar nicht zu: Denn in die Erde hinabgelassen wird der menschliche Körper des Verstorbenen, der dazu noch in einem Sarg liegt.
Erde zu Erde
Eine neue Bestattungsform will den Spruch „Erde zu Erde“ dahingegen wirklich einlösen: Bei der sogenannten „Reerdigung“ werden die sterblichen Überreste in einem sogenannten Kokon vierzig Tage lang auf Heu, Stroh und Pflanzenkohle gebettet, bis die organischen Überreste zu Erde geworden sind – man könnte auch sagen: bis der Leichnam kompostiert ist. Anschließend werden die Knochen, welche von den Mikroorganismen nicht zersetzt werden konnten, noch in einer Mühle zermahlen, bevor sie dem Humus beigemischt werden.
Die US-amerikanische Unternehmerin Katrina Spade hat diese Alternative zur klassischen Sarg- oder Urnenbestattung entwickelt. Im Jahr 2019 wurde im US-Bundesstaat Washington zum ersten Mal eine Reerdigung durchgeführt. Seit 2022 wird diese Methode auch in Deutschland angeboten. Bestattungsgesetze sind in Deutschland Sache der Bundesländer, bislang hat lediglich Schleswig-Holstein die manchmal auch als Kompost-Bestattung genannte Beisetzungsform zugelassen. Die aus den sterblichen Überresten von Verstorbenen gewonnene Erde ist beisetzungspflichtig: Sie muss also auf einem Friedhof vergraben werden und darf beispielsweise nicht im heimischen Garten ausgestreut werden.
Wie an der Ablehnung von Reerdigungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen unter Verweis auf die befürchtete Gefährdung „des sittlichen Empfindens der Allgemeinheit“ deutlich wird, sind mit dieser Beisetzungsform nicht nur juristische, sondern auch ethische Fragen verbunden. Ist die Reerdigung überhaupt mit der Würde des Menschen vereinbar? Handelt es sich bei ihr womöglich sogar um die ethisch bessere Beisetzungsform, etwa weil sie nachhaltiger ist? Kann sie als Ausdruck einer alternativen Mensch-Natur-Beziehung aufgefasst werden, bei welcher die Natur nicht bloß als Ressource angesehen wird?
Menschen zu kompostieren sei würdelos, so die Ansicht mancher Kritiker. Um dieses Argument zu untermauern, verweisen sie unter anderem darauf, dass auch verstorbene Nutz- und Haustiere in Amerika kompostiert werden. Diese Gleichbehandlung von Tieren und Menschen nach ihrem Tod halten die Kritiker der Reerdigung für ethisch fragwürdig. Doch tote Hunde, Katzen oder andere tierische Gefährten können auch in Deutschland auf gesonderten Tierfriedhöfen begraben oder eingeäschert werden. Wenn aber die Nutzung der gleichen Bestattungsmethoden für Mensch und Tier mit Blick auf die klassischen Beisetzungsmethoden nicht als würdelos bemängelt wird, so sollte dies auch hinsichtlich der Kompost-Beisetzung nicht getan werden.
Das Humane als Humus
Die amerikanische Post-Humanistin Donna Haraway sieht dahingegen großes Potential darin, das „Humane als Humus“ zu betrachten – obgleich sie diesen Gedanken nicht im Zusammenhang mit Beisetzungsmethoden äußert. Ihr Lob einer Auffassung vom Humanen als Humus scheint darin zu gründen, dass der Mensch dann nicht länger als ein „den Planeten zerstörende[r] Unternehme[r]“ angesehen werden würde – sondern als ein Wesen, das mit dem Rest der Natur verbunden ist.
Eben dieser Zerstörung des Planeten Erde soll durch die praktische Verwirklichung des Ideals der Nachhaltigkeit Einhalt geboten werden. Ob Ernährung, Mobilität, Wohnen, Bildung oder Reisen: Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht nachhaltig gemacht werden soll. Insofern erscheint es nur folgerichtig, dass der Nachhaltigkeitstrend nun auch nach dem Ableben weitergeht. So bewirbt das Berliner Reerdigungsunternehmen seine Dienstleistung als ökologisch besonders vorteilhafte Bestattungsform. Denn die sogenannten Kokons werden wiederverwendet und die entstandene Erde verbessert die Fruchtbarkeit des Bodens, wodurch zugleich neues Pflanzenwachstum gefördert wird. Bei der Feuerbestattung von Toten entsteht dahingegen viel CO2, bislang werden die meisten Krematorien mit fossilen Brennstoffen betrieben. Zusammengerechnet stoßen alle Krematorien in Deutschland jährlich ungefähr 100.000 bis 250.000 Tonnen Kohlendioxid aus. Zudem bilden sich Giftstoffe, die aus dem Rauch herausgefiltert und auf den Sondermüll gebracht werden müssen. Doch auch klassische Erdbestattungen haben umweltschädliche Folgen: So müssen Bäume für den Sarg gefällt werden, darüber hinaus werden üblicherweise Bagger genutzt, um die tiefe Grube für den Sarg auszuheben. Das Formaldehyd, mit dem Tote einbalsamiert werden, kann später ins Grundwasser sickern und dieses mit gesundheitsschädlichen Stoffen belasten.
Menschlicher Exzeptionalismus
Sowohl die Feuer- als auch die klassische Erdbestattung haben also ökologisch negative Folgen. Sie können mit der australischen Umweltethikerin Val Plumwood, als Ausdrucksformen vom menschlichen Exzeptionalismus bezeichnet werden: Der Mensch versteht sich selbst als außergewöhnlich und außerhalb wie über der Natur stehend. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich auch in den beiden traditionellen Bestattungsmethoden, welche die vermeintliche Höherwertigkeit des Menschen durch kulturell verankerte Praktiken zelebrieren sollen, ohne dabei auf die Auswirkungen auf die Natur zu achten. Obgleich wohl die meisten kulturellen Praxen von der Sonderstellung des Menschen innerhalb der Natur zeugen (wobei mittlerweile auch manche kulturellen Praktiken im Tierreich entdeckt wurden), drücken nicht alle davon diesen Exzeptionalismus in Form einer Absetzung von oder einem zerstörerischen Umgang mit der Natur aus. Plumwood hat sich wiederholt für einen alternativen Umgang mit dem Tod ausgesprochen, bei dem das Lebensende ausgehend von der Reziprozität innerhalb der Erdgemeinschaft betrachtet wird. Nachdem sie bei einer Kanutour durch den Kakadu-Nationalpark im Norden Australiens von einem Salzwasserkrokodil angegriffen wurde und nur schwer verletzt überlebte, veränderte sich ihre Sichtweise auf Leben und Tod, Mensch und Natur von Grund auf: „Seitdem habe ich den Eindruck, dass unsere Weltanschauung das grundlegendste Merkmal der tierischen Existenz auf dem Planeten Erde leugnet – dass wir Nahrung sind und dass wir durch den Tod andere ernähren.“
Den Menschen also als Teil der Natur zu verstehen, der nach seinem Ableben wortwörtlich wieder zu einem Teil der Natur wird, indem sein Körper zerfällt und zu fruchtbarer Erde wird – und diesen Gedanken auch durch eine entsprechende Beisetzungsform auszudrücken – scheint in Zeiten der ökologischen Krise ethisch dringender denn je geboten. Ob es dafür allerdings wirklich die Reerdigung sein muss? Wäre nicht eine Orientierung beispielsweise an jüdischen und muslimischen Bestattungspraktiken, bei denen der Leichnam nur gewaschen und unbekleidet in ein schlichtes Baumwoll- oder Leinentuch gewickelt wird, bevor er begraben wird, viel passender? Denn für die Produktion und Nutzung der technisch hochgerüsteten 'Kokons' der Reerdigungsunternehmen ist der Ressourceneinsatz auch nicht gerade gering. Eine naturnahe Beisetzungsform, die darauf bedacht ist, dass man auch nach seinem Tod möglichst keine Spuren auf der Erde hinterlässt, ist auch ohne die technisch ausgeklügelte Reerdigungsmethode möglich. Wir müssen dafür nur unseren Blick auf traditionelle Bestattungsmethoden anderer Kulturkreise richten. •
Weitere Artikel
Racha Kirakosian: „Im ekstatischen Moment spielt die Zeit keine Rolle“
Was verbindet Gebet, Tanz und Stadionerlebnis? Für die Mediävistin Racha Kirakosian drückt sich darin der Wunsch nach Ekstase aus. Ein Gespräch über Selbstfindung im Selbstverlust.

Kompost statt Grabstätte
Sterbliche Überreste, die zu Erde werden und im Blumentopf landen? Was ungewöhnlich klingt, ist nun auch im Bundesstaat New York legalisiert worden: „Human Composting“. Warum wir lernen müssen, den Menschen als Humus zu begreifen, weiß die Philosophin Donna Haraway.

Kosmo-politisch
War der Weltraum lange Zeit ein Spielfeld für expansive Technik und Forschung, bahnt sich nun die Idee der Nachhaltigkeit einen Weg in die Umlaufbahn der Erde.

Die andere Hannah Arendt
Thomas Meyer lässt die Legenden beiseite und leistet historische Detailarbeit: Seine Biografie erforscht das bisher kaum beachtete zionistische Engagement Hannah Arendts – und ermöglicht einen neuen Blick auf das Leben der Denkerin.
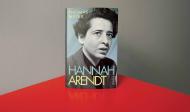
Peter Singer: „Der Impfstoff ist eine große Herausforderung“
Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen BioNTech und der amerikanische Pharmakonzern Pfizer verkündeten jüngst, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 in der Phase-3-Studie eine 90-prozentige Wirksamkeit aufweise. Damit rückt eine Zulassung in greifbare Nähe. Gleichzeitig wird dadurch aber auch die Frage virulent, nach welchen Kriterien er verteilt werden sollte. Der australische Philosoph Peter Singer, Mitbegründer des „effektiven Altruismus“ und einer der einflussreichsten Denker der Gegenwart, spricht im Interview über die ethischen Herausforderungen, die mit dem Impfstoff verbunden sind.

Marie-Luisa Frick: „Wir müssten aus der Durchseuchungsstrategie eine Tugend machen“
Österreich will an einer allgemeinen Impfpflicht ab Februar festhalten. Gleichzeitig werden die Rufe nach einem Strategiewechsel lauter. Die Innsbrucker Philosophin Marie-Luisa Frick über ethische Implikationen, die humane Seite der Biopolitik und die Herausforderungen der Zukunft.

Lust am Überschuss
Fortnite hat sich zum erfolgreichsten Onlinespiel aller Zeiten entwickelt. Das Erfolgsrezept des Shooters liegt jedoch nicht im virtuellen Töten – sondern im anschließenden Tanzen
Andreas Kümmert - Ruhmverweigerer
Es hätte sein Monat, sein Ereignis werden können. Womöglich wäre er – wie einst Lena Meyer-Landrut – sogar zum internationalen Star avanciert.